Vorwort
Ginge es nach dem Willen unserer Freunde, die sich für ein aufgeweichtes Urheberrecht und die weltweite Durchsetzung von »Open Access« erwärmen, wäre die Verbesserung der Wissenschaft ein Klacks: Die Wissenschaftler dürften nicht mehr eigensinnige Wege gehen, um ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, sondern müßten sich dazu bequemen, auf ebenjenen Wegen zu veröffentlichen, die unsere Freunde in den Bibliotheken, den Wissenschaftsministerien und den wissenschaftlichen Förderorganisationen für die richtigen halten. Wobei der Plural, überlege ich’s recht, hier eigentlich fehl am Platz ist, denn es gibt für die Genannten nur einen Weg der angemessen-besten Veröffentlichung von Wissenschaft, und dieser Weg heißt »Open Access«.
Viele meinen, das sei einfach ein Synonym für so etwas wie eine »digitale Publikation auf dem Volltextserver einer Universität«. Das aber ist ein ganz falsches Meinen; richtig ist vielmehr dies: Die Wissenschaftler sollen nach dem Willen der »Open-Access«-Befürworter so veröffentlichen, daß es für alle an Wissenschaft Interessierten möglichst bequem ist, an das Veröffentlichte heranzukommen und das von anderen Veröffentlichte nach Lust und Laune weiterzuverarbeiten. Das ist der Grund, warum auf der »Informationsplattform open-access.net« sehr ausführlich für solche Veröffentlichungslizenzen geworben wird, die eine »Nachnutzung« des Veröffentlichten erlauben: Es geht bei »Open Access« darum, wissenschaftliche Veröffentlichungen beliebig in andere Kontexte transponieren, beliebig bearbeiten und beliebig verändern zu dürfen — alles das meint das Wort »Nachnutzung« —, ohne den Autor (den Rechteinhaber) fragen zu müssen. Damit wandert die Verfügungsmacht über die Texte von den Autoren zu den »Nutzern«, und das ist des Pudels Kern von »Open Access«.
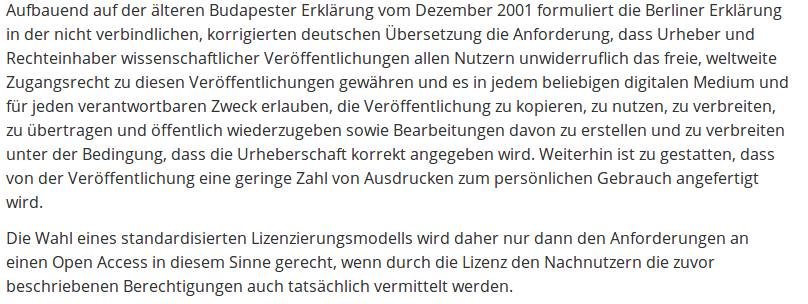 [Abb. 1:
Nachnutzung als juristisches Paradigma für »Open-Access«. Quelle:
https://open-access.net]
[Abb. 1:
Nachnutzung als juristisches Paradigma für »Open-Access«. Quelle:
https://open-access.net]
Daß diese Verschiebung in der Verfügungsgewalt über Texte eine gute Idee sein könnte, ist eine Kopfgeburt, die aus dem immer größer werdenden Reich der Software stammt. Dort, in dieser Welt der Bits und Bytes, entsteht Software als ein Text, der eine Ausführungsanweisung für eine Maschine darstellt; und solche Ausführungsanweisungen kann man im Hinblick auf das Auszuführende besser oder schlechter machen, man kann sie erweitern um zusätzliche Anweisungen, man kann sie mit anderen Anweisungen kombinieren — und was einem sonst noch so einfällt, wenn man sich um Maschinen zu kümmern hat, die Dinge tun sollen. Daß man bei dieser Textbastelei, die gerne in Gruppen stattfindet, nicht immer bei den früheren Textbastlern, deren Text man verändernd weiterschreiben möchte, nachfragen will, ist verständlich, denn nicht der Text ist das Ziel der programmierenden Textverfasser, sondern die damit zu erreichende Ausführungsanweisung für die Maschine.
Bei wissenschaftlichen Texten aber geht es nicht um kollektiv erzeugte Ausführungsanweisungen für Maschinen. Und daher machen die genannten Lizenzmodelle, die die »Nachnutzung« zum Maß aller Dinge erheben, für wissenschaftliche Texte nicht nur keinen Sinn, sondern führen schnurstracks zu einer dauerhaften Beschädigung von Wissenschaft. Wissenschaft muß nämlich, solange sie Wissenschaft sein will, den Umgang mit ihren Texten in selbstverantwortlicher Weise gestalten können, und das heißt nichts anderes, als daß sie in der Lage sein muß, unstatthafte, weil verfälschende Bearbeitungen von Veröffentlichungen zu verhindern. Denn die vielen Texte der Wissenschaft bilden insgesamt nicht einfach eine Riesensoftware, die eine Art universale Wahrheitsmaschine am Laufen hält, sondern jeder einzelne dieser Texte steht in seinem Wahrheitsgehalt in Frage und muß daher als dieser Text, der er ist, verantwortet werden können; und das heißt: der Autor muß als die Quelle des Textes für seinen Text eintreten, muß ihn verteidigen können.
Natürlich — ich weiß — wollen das unsere »Open-Access«-Freunde und Urheberrechtsaufweicher nicht wahrhaben. Sie träumen unverdrossen von einer Zukunft, in der alle Wissenschaft der Welt unter einer Creative-Commons-Lizenz zur Nachnutzung freigegeben ist. Was sie nicht wissen, weil sie immerzu nur in die Zukunft starren, ist, daß wir in Deutschland in der Vergangenheit schon einmal einen Zustand hatten, der dem Ziel von »Open Access« nahezu entspricht. Und dieser Zustand hat die Wissenschaft in Deutschland keineswegs beflügelt, sondern eine Situation heraufbeschworen, in der nicht mehr Argumente ausgetauscht, sondern gehässige Feindschaften öffentlich ausgetragen wurden, lange vor Twitter, mit dem einfachen Mittel des Pamphlets. Am Ende dieses Prozesses stand nicht der lebhafte Dissens in der Sache, in dem die Sache zu leuchten beginnt; am Ende stand das Schweigen. Und in diesem Schweigen kollabiert die Wissenschaft, damals wie heute und in Zukunft.
Das ist die Lektion, die wir aus dem Fall Schelling zu lernen haben.
Lektion
Im Oktober 1841 kommt Schelling nach Berlin, um den ehemaligen Lehrstuhl Hegels zu übernehmen. In Berlin wird er von den meisten Hegelianern feindselig empfangen; man schreibt über ihn, er sei »der eklatanteste Abfall von aller Philosophie überhaupt« (Ruge), er sei der »Judas Ischariot der Philosophie« (Feuerbach), seine Berufung »Hohn und Schelte auf den geschmähten Hegel« (Hinrichs).
Schelling war sich der Situation bewußt, in die er da geriet, und es ist überliefert, daß er bei dem zu seinen Ehren veranstalteten Begrüßungsbankett im Wissenschaftlichen Kunstverein nichts zu sich nehmen konnte und in den folgenden Wochen von Beschwerden geplagt wurde, die man psychosomatisch nennen muß. Gleichwohl sah er sich in der Lage, seine Antrittsvorlesung über die Philosophie der Offenbarung am 15. November um 17 Uhr zu beginnen; und auch wenn er seinen ehemaligen Freund und Mitarbeiter Hegel darin nicht erwähnte, versuchte er doch sofort deutlich zu machen, daß er keine »Wunden schlagen, sondern die Wunden heilen« wolle: »Nicht aufreizen will ich, sondern versöhnen…«
Das hat unter seinen Gegnern nicht gefruchtet. Friedrich Engels machte sich daran, Schelling als »Philosophen in Christo« zu denunzieren und publizierte zu diesem Zweck gleich zwei Kampfschriften, in denen er auf der Basis seiner eigenen Vorlesungsaufschriebe den vorlesenden Schelling mit einem kritisch kommentierten Schelling zu widerlegen versuchte. Und Schellings ehemaliger Freund Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, längst zu einem erbitterten Gegner geworden, ließ sich über den Hegelianer Marheinecke eine Mitschrift der gesamten Vorlesung besorgen, um sie 1843 unter dem umständlichen Titel Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung oder Entstehungsgeschichte, wörtlicher Text, Beurtheilung und Berichtigung der v. Schellingichen Entdeckungen über Philosophie überhaupt, Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Christenthums im Berliner Wintercursus von 1841–42 bei Leske in Darmstadt zu veröffentlichen, vermehrt um eigene Kommentare, die den Umfang der Schellingschen Vorlesung um mehr als das Doppelte übertrafen und ein einziges Ziel verfolgten: Schelling intellektuell zu diskreditieren.
 [Abb. 2:
Schelling. Quelle: Joseph Karl Stieler [Public domain], via Wikimedia Commons.]
[Abb. 2:
Schelling. Quelle: Joseph Karl Stieler [Public domain], via Wikimedia Commons.]
Schelling hat sich gegen diese Publikation seiner Vorlesung gewehrt, und er hatte allen Grund anzunehmen, daß seine Gegenwehr erfolgreich sein werde. Erstens hatte die Bundesversammlung bereits 1837 einen Beschluß gefaßt, der es untersagte, »literarische Erzeugnisse aller Art, sie mögen bereits veröffentlicht seyn oder nicht, […] ohne Einwilligung des Urhebers oder desjenigen, welchem derselbe seine Rechte an dem Originale übertragen hat, auf mechanischem Wege« zu vervielfältigen (Art. I). Und in Art. IV desselben Beschlusses war festgelegt worden, daß im Falle der Zuwiderhandlung dem Urheber »Anspruch auf volle Entschädigung« zustehe. Zweitens gab es in Preußen seit 1837 ein Gesetz zum Schutz des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung, in dessen § 3 es hieß: »dem [verbotenen] Nachdruck wird gleich geachtet und ist daher wie dieser verboten der ohne Genehmigung des Autors oder seines Rechtsnachfolgers bewirkte Abdruck von nachgeschriebenen Predigten und mündlichen Lehrvorträgen, gleichviel ob dieselben unter dem wahren Namen des Autors herausgegeben werden oder nicht«. Und drittens schließlich erlaubte auch das damalige hessische Urheberrecht in seinem § 5 nur dann den Abdruck wörtlicher Auszüge eines anderen Werkes, wenn diese »beiläufige Bestandtheile« blieben. Schelling hatte also das Bundes- und das Landesrecht auf seiner Seite, und dennoch verlor er in allen drei Instanzen vor den Gerichten in Darmstadt, Berlin und Leipzig.
Die Gerichte nämlich waren — in krassem Gegensatz zur Gesetzeslage — der Meinung, es sei durch Paulus kein Werk Schellings plagiiert worden, weil ein solches Werk Schellings gar nicht gedruckt vorliege; und weil die von Paulus in Umlauf gebrachte Version von Schellings Vorlesung über die Philosophie der Offenbarung kein bereits von Schelling in Druck gegebenes Werk nachdrucke, sei Schelling und seinem Verleger Cotta auch kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Mit anderen Worten: Die Richter argumentierten zum einen ökonomisch und lasen damit an den Gesetzen vorbei, denen es um den Schutz des Werkes und damit um die Souveränität des Autors über dieses sein Werk gegangen war, nicht aber um den wirtschaftlichen Nutzen oder Schaden. Zum andern argumentierten die Richter vom Standpunkt einer Öffentlichkeit aus, deren Informationsbedürfnisse sie für wichtiger hielten als das Bedürfnis Schellings, seine Überlegungen zwar öffentlich vorzutragen, nicht aber zu drucken: Nur der Nachdruck eines bereits gedruckten Werkes wäre für die Richter strafbar gewesen; der Druck eines ungedruckten, aber öffentlich vorgetragenen Werkes war für die Richter dagegen die drucktechnische Umsetzung der Intention Schellings, die Öffentlichkeit über seine Gedanken zu informieren; und einmal durch Vortrag öffentlich geworden, lag die Souveränität über das mündlich Veröffentlichte in den Augen der Richter nicht mehr beim Vortragenden, der es sich vielmehr gefallen lassen mußte, seine Gedanken von fremder Hand zum Druck befördert zu sehen. Auch das war an den Gesetzen vorbeigelesen und -gedacht, für die nicht die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit entscheidend waren, sondern allein der Wille des Autors, seinen Gedanken eine bestimmte gedruckte Werkgestalt zu geben oder diese Werkgestalt zu verweigern.
Mit anderen Worten: Die Gerichte in Darmstadt, Berlin und Leipzig argumentierten nicht anders als die heutige »Open-Access«-Bewegung, die den Nachnutzungswillen der Öffentlichkeit über den Werkwillen der Autoren setzt. Ein Satz aus damaliger Zeit bringt diese Gesinnung aufs deutlichste zum Ausdruck und könnte als Motto auf jedem der Strategiepapiere stehen, mit denen uns die »Open-Access«-Bewegung seit Jahren unterhält: »Wie ein Erfindungspatent durch Nichtgebrauch erlischt, so hat auch Schelling durch sein beharrliches Schweigen [gemeint ist: das Nichtdrucken seiner Vorlesungen] das Recht verwirkt, anderen die öffentliche Mitteilung seiner Erfindungen zu verbieten.«
Schelling reagierte auf den verlorenen Prozeß in der einzig angemessenen Weise: Um die Souveränität über seine Philosophie der Offenbarung zu wahren, trug er über dieses Thema nicht mehr vor, und 1846 stellte er seine öffentliche Vorlesungstätigkeit ganz ein. Schelling schwieg souverän.
Nachwort
Ich bin sicher, daß meine »Open-Access«-Freunde diese Lektion mißverstehen werden. Sie werden der Meinung sein, der Fall Schelling bestätige das legitime Bedürfnis der Öffentlichkeit an Informationen, die zwar eine denkende Quelle benötigten, ansonsten aber beliebig nachnutzbar sein sollen. Und sie werden sich darüber freuen, daß das Recht eine so wunderbare Sache ist, daß man es zeitgeistig anpassen kann, um es als Richterrecht über den Gesetzestext zu stellen und also eine »Open-Access«-Logik dort hineinzulesen, wo das Gegenteil steht.
Das Schweigen Schellings aber widerlegt meine »Open-Access«-Freunde: Wo immer sie gewonnen haben und wo immer sie gewinnen werden, haben die Autoren verloren und werden die Autoren verlieren, und wo die Autoren verlieren, verliert zuletzt die Öffentlichkeit. Sie verliert, was sie allererst zur Öffentlichkeit macht: die gesellschaftliche Austauschsphäre, in der sich Personen frei begegnen können, um aufeinander zu hören und miteinander zu sprechen, ohne daß dabei der eine den andern zum Objekt seiner Interessen macht und ihn um solcher Interessen willen übervorteilt.
Paulus hatte solche Interessen, er haßte Schelling, und er stand nicht an, diese seine Interessen und seinen Haß gegen Schelling in Stellung zu bringen, den öffentlich sprechenden mit einem nachgedruckten Schelling bekämpfend, und er tat das in einem Umfeld, in dem ein Teil der Öffentlichkeit dasselbe Kampfinteresse hatte oder doch zumindest das Interesse, die Gedanken Schellings in Form eines gedruckten Buches nachnutzen zu dürfen. Paulus hat diese Interessen ausgespielt, ein Teil der Öffentlichkeit und der Justiz hat mitgespielt — und alle diese Spieler haben zuletzt verloren. Denn am Ende der Prozesse war klar, was auf dem Spiel stand, die gute Gesellschaft, die es damals noch gab, wendete sich von Paulus ab, und die nachfolgende Juristengeneration hatte verstanden, daß es zuallererst um die Souveränität des Autors gehen muß und nicht um die Interessen des Publikums — und daß das der Sinn des Urheberrechts ist. Mit anderen Worten: Indem Schelling den Prozeß verlor, hat die Sache Schellings gewonnen. Die »Community«, die sich hinter der »Open-Access«-Fahne sammelt und von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen mit vielen Fördergeldern und also Steuermitteln am Leben gehalten wird, sollte die Lektion, die der Fall Schelling erteilt, als Menetekel lesen.
Nachweise
Für den Beitrag habe ich folgende Werke benutzt:
Xavier Tilliette: Schelling. Biographie. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004. Darin das Kapitel 16: »In der Höhle des Drachen«.
Schelling und Cotta. Briefwechsel 1803–1849. Stuttgart: Klett, 1965. Darin die Briefe Nr. 208–217 und die Kommentare dazu.
Brigitte Hilmer: Geschäftsführung ohne Auftrag. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Mai 2009, Nr. 137, S. N3.
Eine Quelle zum Prozeß Schellings
Der nachfolgend abgedruckte Text erschien zuerst in Beilage der Augsburger Allgemeinen Zeitung, dem damals wichtigsten in Deutschland erscheinenden Blatt. Sein Autor, Julius Eberhard Hitzig (1780–1849), der zunächst anonym blieb, war Richter am Berliner Kammergericht und galt nicht nur als Sachverständiger für das Pressewesen, sondern auch als führender Urheberrechtler. Hitzig irrte sich mit seiner Vermutung, Paulus habe mit dem Nachdruck der Schellingschen Vorlesung Geld verdient; Paulus verschenkte das Buch vielmehr an alle Interessierten. Auch das sozusagen im Sinne von »Open Access« lange vor »Open Access«. In allem anderen irrte sich Hitzig nicht.
[Julius Eberhard Hitzig:] Nachdruck zu gutem Zweck. In: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 272, 29. September 1843, S. 2128–2129.
[S. 2128]
Nachdruck zu gutem Zweck.
Unter dieser Ueberschrift sagt die Allg. Preßzeitung: »Vor kurzem durchlief die Nachricht alle Zeitungen, daß der alte achtzigjährige Dr. Paulus in Heidelberg eine ausführliche Widerlegung der Offenbarungsphilosophie des Dr. Schelling herausgegeben und zu diesem Zweck die noch nicht im Druck erschienenen Vorlesungen des letzteren, welche jetzt zum erstenmal veröffentlicht worden, durch einen Zuhörer habe nachschreiben lassen. Wir setzten — wie unerklärlich es uns schien — voraus daß er dazu die Einwilligung des Verfassers erlangt haben werde; denn wir konnten uns nicht denken daß der Erfinder der Denkgläubigkeit, ein Mann welcher aus dem Christenthum die Lehre von der angebornen Sündhaftigkeit gestrichen und wesentlich dazu beigetragen hat das Christenthum selbst auf eine nackte und unerbittliche Moral zurückzuführen, sich eines unerlaubten Mittels — streng genommen eine gemeinen Diebstahls — bedient haben werde um seinen Zweck, wenn auch in seinen Augen einen verdienstlichen, zu erreichen und an der Offenbarungsphilosophie zum Ritter zu werden, wie er es am Christenthum geworden ist. Um so mehr freuen wir uns zu vernehmen daß Schelling den frommen Zweck nicht als Entschuldigung eines schlechten Mittels betrachtet und wegen des verübten Nachdrucks klagbar geworden ist. Die Schrift des Doctor ist in Preußen als Nachdruck mit Beschlag belegt worden und müßte als solcher, würde darauf angetragen, in ganz Deutschland mit Beschlag belegt werden. Von dem Ausgange des eingeleiteten Processes aber hoffen wir spätere Mittheilungen machen zu können.«
Berlin, 8 September. Es gibt ein altes Geschichtchen von zwei Besenbindern, von denen der eine zu dem andern sprach: Gevatter, ich stehle doch auch alle Zuthat zu meinen Besen, und dennoch kann ich sie nicht so wohlfeil geben wie du; der andere aber erwiederte: das geht sehr einfach zu, denn ich stehle gleich die ganzen Besen. An diese Historie ist Ihr Correspondent lebhaft erinnert worden durch die Stelle in Dr. Paulus’ seit einigen Tagen hier verbreiteter »vorläufigen Appellation an das Publicum« (S. 11. ff.) worin derselbe in seinem famosen Handel mit Schelling erklärt »seine (Paulus) Vorgänger, Frauenstädt, Alexis Schmidt, Fr. Oswald u.a. hätten sich die Mühe gegeben, Auszüge aus Schellings Vorlesungen mitzutheilen; in seinem Buche finde man sie aber vollständig abgedruckt.« Eine merkwürdige psychologische Erscheinung ist die gänzliche Abwesenheit alles Rechtsgefühls in der Brust des alten Mannes, wie sie aus dem erwähnten Pamphlet hervorgeht und wie sie sich sonst nur bei jenen Leuten vorfindet die, wenn sie vor den Richter gestellt werden, antworten: wir würden die Sache ja nicht gestohlen haben, wenn wir sie nicht gar zu nöthig gebraucht hätten. In der That läuft die ganze Ausführung in der Vertheidigungsschrift des Verfassers darauf hinaus. Er geht nämlich davon aus (S. 12) daß der Abdruck des Collegienhefts ihm zur Widerlegung unentbehrlich gewesen sey — ergo; einen Frevler an fremdem Eigenthum, der sich auf diesen Standpunkt stellt, von seinem Unrecht zu überzeugen, hieße den Versuch machen einen Mohren weiß zu waschen. Doch wollen wir im Namen des »wahrheitwollenden Publicums,« an welches Paulus ausdrücklich seine Appellation richtet, ihn zum Beweis über eine Thatsache auffordern, deren Aufklärung zur Feststellung der öffentlichen Meinung über den vorliegenden Fall von größter Erheb- [S. 2129] lichkeit ist. Er räumt nämlich (S. 14) ein daß der Text der Schelling’schen Vorlesung etwa den vierten Theil seines 46 Bogen starken Buchs betrage.1 Kann er nun, durch ein beglaubigtes Attest seines Verlegers, darthun daß er sich diesen Theil, also circa zwölf Bogen, nicht habe honoriren lassen, so soll ihm der Ruf Crispini unbestritten seyn, der dem Reichen das Leder stahl, um den Armen (hier den Armen die auf seine Widerlegung der Offenbarungsphilosophie warteten) Schuhe daraus machen zu lassen. Kann er diesen Beweis nicht führen; hat er sich für das was ein anderer gedacht, niedergeschrieben, vorgetragen hat, bezahlen lassen; — dann… Aber wir wollen dem Urtheil eines jeden Unbefangenen nicht vorgreifen und warten, ob der sich im Kampfe so wohl gefallende Greis diesen Fehdehandschuh aufnehmen wird. Noch ein Wort bleibt zu sagen über die Erwartung welche er (S. 15) ausspricht, daß kein Gericht ihn, wenn Schelling gegen ihn klagt (was er hoffentlich im Bewußtseyn seines guten Rechts schon gethan hat), wegen verübten Nachdrucks werde verurtheilen mögen. Wir hegen gerade die entgegengesetzte Ueberzeugung daß kein deutsches Gericht sich mit der Schmach bedecken werde den offenbaren litterarischen Diebstahl in Schutz zu nehmen. Zwar erfreuen sich nicht alle deutschen Staaten eines Gesetzes zum Schutz des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst, in welchem der hier vorliegende Fall mit so bestimmten Worten vorgesehen worden als das unsrige von 1837, in dessen §. 3 ausdrücklich vorgeschrieben ist: »dem Nachdruck wird gleich geachtet und ist daher wie dieser verboten der ohne Genehmigung des Autors oder seines Rechtsnachfolgers bewirkte Abdruck von nachgeschriebenen Predigten und mündlichen Lehrvorträgen, gleichviel ob dieselben unter dem wahren Namen des Autors herausgegeben werden oder nicht«; aber daß beiden Handlungen, dem ohne den Willen des Autors bewirkten Abdruck seiner von ihm noch nicht zum Druck bestimmten mündlichen Vorträge und dem wirklichen Nachdruck eine gleiche Criminalität zuzuschreiben sey, dieß liegt so unverkennbar in den ersten Begriffen von den Rechten des Autors daß es eine Unmöglichkeit scheint irgend ein deutsches, aus wissenschaftlich gebildeten Mitgliedern zusammengesetztes Gericht könne dieß verkennen. Auch das großherzoglich hessische — das Gesetz der Heimath seines Verlegers — hinter welches sich Paulus versteckt, und welches nach dem von ihm angeführten §. 5 für erlaubt erklärt »wörtliche Auszüge eines ganzen Werks als beiläufige Bestandtheile oder Beilagen anderer Schriften«2 auf ein nachgeschriebenes Collegienheft in seiner ganzen Vollständigkeit zu beziehen, wäre offenbar Unsinn; denn ein Ganzes ist kein Auszug, und Paulus weist ja oft genug darauf hin daß man bei ihm das ganze Schelling’sche Heft finde. Ein solcher Unsinn ist aber keiner deutschen Spruchbehörde zuzutrauen. Also wenn Paulus sich mit dem Satz tröstet den er als Motto für seine Schrift gewählt hat, lex tuetur bene merentes [das Gesetz schützt jene, die sich Verdienste erworben haben], so vergessen wir auch nicht daß es auch leges [Gesetze] gibt die ihre Uebertreter gebührend zu strafen wissen.
-
Wahr ist es nicht: die gute Hälfte des Buchs ist fremdes Eigenthum. Anmerk. d. Corresp. ↩
-
Ein anderer von Paulus klüglich übergangener Paragraph desselben großherzogl. hessischen Gesetzes vom Jahr 1830, der durch den angeführten §. 5 nur beschränkt wird, bestimmt ausdrücklich daß jeder Abdruck von Vorlesungen und Predigten der ohne Genehmigung des Autors geschieht als Nachdruck anzusehen ist. A. d. Corresp. ↩
