Wir sind, so sagte es Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vor einigen Jahren auf einer Tagung, wir sind neuerungssüchtige Lebewesen. Was neu ist, interessiert und fesselt uns; was aber alt ist, langweilt uns — und irgendwann werfen wir’s weg. Nur Messies machen es anders: Krankheitsbedingt können sie sich von nichts trennen und ersticken allmählich im Müll.
 [Abb. 1:
Messie. Quelle: Grap, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).]
[Abb. 1:
Messie. Quelle: Grap, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).]
Schaut man auf die Kultur insgesamt, ist es nicht anders: Auch hier ist das Neue das Faszinosum schlechthin. Das gilt von der hohen Kultur ebenso wie von der nicht so hohen, und es gilt erst recht von dem riesigen Komplex des Konsumismus, der sich als Kultur verkauft und davon lebt, mit dem Faszinosum des Allerneuesten Kasse zu machen. Ansonsten schiebt man alles, was kulturell nicht mehr neu und unverkäuflich ist, beiseite und in ein Museum, ein Archiv oder eine Bibliothek, wo es vor sich hinstauben kann. Um zu verhindern, daß es dort zum messiehaften Kulturmüll wird, trennt man die Spreu vom Weizen, nimmt im Archiv also nur das zuvor als archivwürdig beurteilte Material an, sammelt im Museum das künstlerlisch Beste und in der Bibliothek die in ihrer Zeit relevanten Bücher. Alles aber, was man für sammlungswürdig hält, betreut man professionell, inventarisiert und katalogisiert es — auf jenen überraschenden Augenblick wartend, da ein neugieriger Blick auf das verstaubte Alte fällt und erstaunt feststellt, wie neu es erscheint. Dann folgt gelegentlich so etwas wie eine »Renaissance«, und man schilt laut die dummen Altvorderen, die das Alte ins Archiv und Museum abschoben und verstauben ließen, ohne seine Aktualität und Relevanz und seinen Wert — und schon wird es wieder ökonomisch — wahrzunehmen. Vielleicht ordnet man sogar den kulturellen Kanon neu und schickt die letzten zwei oder drei Trends, die man saumäßig durchs Kultur- und Zivilisationsdorf gejagt hatte, in den Ruhestand; übrigens samt all der eifrigen Advokaten des stets Allerneuesten, die dachten, die Geschichte kenne nur eine Richtung (»Fortschritt«) und die nun feststellen müssen, daß hinter ihrem Rücken das Alte und vermeintlich Abgetane nicht abgestorben ist, sondern sich nur eingekapselt hatte, um vom neugierigen Blick aus seiner Zeitkapsel befreit zu werden.
 [Abb. 2: Alte Bücher. Quelle:
Pixabay.]
[Abb. 2: Alte Bücher. Quelle:
Pixabay.]
So müßte es in der besten aller möglichen Welten sein; und gelegentlich ist es tatsächlich so. Immer häufiger aber ist es anders. Seit einigen Jahren nämlich kann man beobachten, daß diejenigen, die man vertrauensvoll für die professionellen Sachwalter des Alten hielt, sich als Anwälte des Allerneuesten entpuppen und in Archiv, Museum und Bibliothek dafür sorgen, daß das Alte nicht mehr alt bleibt. Das macht man so, daß man die »Altbestände« digitalisiert und die nun ganz neu digitalisierten Bestände an das Neueste und Schickste, das Internet, anschließt: So kooperiert beispielsweise das Prado-Museum mit Google, um seine Bilder digital ins Netz zu bringen, andere Museen tun’s ihm gleich, und auf der Seite der Bibliotheken hat die Bayerische Staatsbibliothek in München in Zusammenarbeit mit Google seit dem Jahr 2007 weit mehr als eine Million Bücher digitalisiert.
Die Öffentlichkeit nimmt das als Fortschritt wahr und läßt sich gerne sagen, wie wunderbar es ist, daß hier das »Wissen der Menschheit« dank neuester Technik planetar verbreitet wird. Was die Öffentlichkeit aber nicht wahrnimmt, weil es ein unangenehmer Teil der Wahrheit ist, den man ihr lieber verschweigt, ist der Umstand, daß die digitale Aufmotzung der »Altbestände« zu deutlichen Verwerfungen im Umgang mit dem, was eigentlich auf immer aufbewahrt werden sollte, geführt hat. Das betrifft weniger die Archive und Museen, in denen per definitionem Unikales gesammelt wird; es betrifft aber ganz gewiß die Bibliotheken, die seit der Zeit Gutenbergs Bücher sammeln, die als einzelne Exemplare einer ganzen Druckserie (Auflage) produziert wurden. Denn auf die Frage, wie in einer Bibliothek mit den Exemplaren gedruckter Bücher und Zeitschriften umzugehen sei, die es auch an anderen Bibliotheken gebe und die obendrein doch gerade digitalisiert wurden und nun »im Netz vorhanden« seien — auf diese Frage haben meine Bibliotheksfreunde eine zumeist verblüffend einfache Antwort: Man kann solche Bücher und Zeitschriften schlicht und einfach »aussondern«; und das heißt: wegwerfen (es sei denn, ein Antiquar erbarmt sich ihrer).
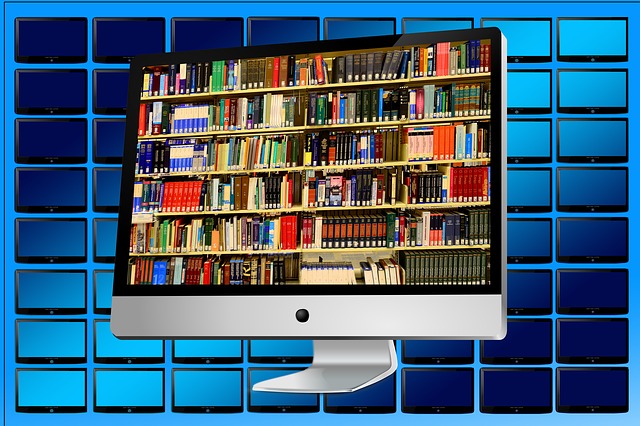 [Abb. 3: Bildschirm-Bibliothek.
Quelle: Pixabay.]
[Abb. 3: Bildschirm-Bibliothek.
Quelle: Pixabay.]
Daß diese Bücher und Zeitschriften durch ihre einstige Übernahme in den Bibliotheksbestand dort zu einem Teil der Sammlung wurden und damit auch eine eigene Geschichte entfaltet haben (sie wurden benutzt oder auch nicht), daß sich in ihnen womöglich Randnotizen mehr oder weniger intelligenter Leser finden, die Rückschlüsse auf den Zeitgeist zulassen, daß es Provenienzvermerke gibt, die Aufschluß über das Woher der Bücher und Zeitschriften geben — daß aus alldem sich große Perspektiven auf unser kulturelles Ensemble ergeben können — geschenkt; denn nun, so höre ich immerzu, habe man ja die Digitalisate, brauche die gedruckten Exemplare also nicht mehr; denn, nicht wahr, bei Gedrucktem aller Art komme es ja zuletzt nur auf den »Inhalt« an, und der sei im Digitalisat genau derselbe wie im gedruckten Exemplar. Und wer, bitte schön, möchte schon all die launigen Randbemerkungen und Besitzstempel für relevant halten, die sich im Laufe der Jahre aufs Papier drängten, all die »!«, »?«, »aha«, »gut«, »Idiot«, »Aus der Sammlung Batt«, »Wilhelmius fecit«, »Universitätsbibliothek Königsberg«? Das kann zusammen mit dem gedruckten Exemplar jetzt einfach weg; statt dessen sollen wir auf Bildschirme schauen, auf denen uns unsere Kultur entgegenleuchtet, so digital frisch und neu wie nur irgendwas.
Fragt man nach den Ursachen für diesen laxen Umgang der Bibliotheken mit der ihnen anvertrauten Druckgeschichte, die der umfangreichste Teil unserer kulturellen Überlieferung ist, hört und liest man oft, es seien der Platzmangel in den Bibliotheken und/oder die durch die Zusammenlegung von Institutsbibliotheken überflüssig gewordenen Mehrfachexemplare, die eine Aussonderung von Bibliotheksbeständen nötig mache. Was man aber nicht hört und nicht liest, ist der einfache Hinweis, daß aus einem Platzmangel eigentlich die Forderung nach mehr Platz — also nach Bibliotheksneu- und -anbauten — folgen sollte. Und schon gar nicht hört und liest man, welche Gründe es gibt, die in den Bibliotheken und im Kopf der Bibliothekare dafür sorgen, diese naheliegende Forderung nicht zu erheben. Das mag einfach daran liegen, daß wir uns hier nicht in der entspannten Zone des Austauschs von guten und besseren Argumenten bewegen, sondern in der heißen Zone eines kurrenten bibliothekarischen Selbstbildes, das, wie immer in solchen Fällen, seinen eigenen blinden Fleck nicht zu sehen vermag, dafür aber um so heftiger um sich zu schlagen beginnt, wenn man diesen blinden Fleck berührt.
 [Abb. 4: Der blinde
Fleck. Quelle: Ske, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).]
[Abb. 4: Der blinde
Fleck. Quelle: Ske, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).]
Zu diesem Selbstbild gehört nicht einfach, daß Bibliothekare sich als »Informationsspezialisten« verstehen, die mit »irgendwas mit Information« meinen, sie würden dadurch zu »Wissensexpertinnen und -experten in der Informationsgesellschaft«:
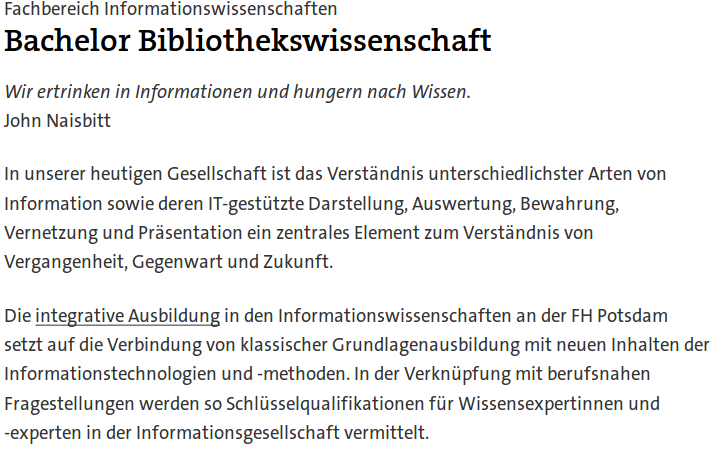 [Abb. 5: Fachhochschule
Potsdam, Studiengang Bibliothekswissenschaft. Quelle: FH
Potsdam.]
[Abb. 5: Fachhochschule
Potsdam, Studiengang Bibliothekswissenschaft. Quelle: FH
Potsdam.]
Vielmehr ist integraler Bestandteil dieses Selbstbildes die sehr massive Digitalideologie, die dafür sorgt, daß die sich als Informations- oder Wissensspezialisten verstehenden Bibliothekare die in den Bibliotheken vorhandenen Bücher und Zeitschriften nicht mehr als konkrete Buchexemplare und damit als Elemente einer komplexen Kulturgeschichte zu sehen vermögen, sondern nur noch als papierene »Container« für einen »Inhalt«, der, so die Überzeugung, exemplar- und damit auch medienunabhängig irgendwie derselbe bleibe. Und folglich wirft der bibliothekarische Informations- und Wissensspezialist als Altes weg, was er nun in digital-neuer Form als dasselbe zu haben meint.
Daß das kein bloßer Verdacht ist, sondern bibliothekarische Realität, läßt sich statistisch in recht unschöner Weise zeigen. So hat die Leiterin der Landesbibliothek Oldenburg vor einiger Zeit die Wegwerfaktivitäten der Bibliothekare statistisch erhoben und festgestellt, daß von 1999 bis 2015 in den deutschen Universal- und Hochschulbibliotheken insgesamt 24,4 Mio. Bände weggeworfen wurden, davon alleine 18,3 Mio. Bände in den Universitätsbibliotheken. Diese Wegwerfaktionen verteilen sich freilich nicht linear auf den genannten Zeitraum, sondern so, daß knapp die Hälfte der weggeworfenen Bücher im letzten Drittel des Zeitraums weggeworfen worden war; die Kollegin aus Oldenburg nennt das eine »dynamische Steigerung«. Diese Dynamik zeigt sich nicht zuletzt daran, daß die Aussonderungsquote (das Verhältnis zwischen Zugängen und Abgängen) in den Bibliotheken deutlich zugenommen hat:
| 1999–2015 | 38 Prozent |
| 2005–2015 | 50 Prozent |
| 2010–2015 | 61 Prozent |
Was einst eine »Katastrophe« genannt worden war, nämlich der Verlust von rund 25 Mio. Bibliotheksbänden im Zweiten Weltkrieg, ist, wie man sieht, in den Bibliotheken längst zur »Normalaufgabe« geworden, die als »Deakzession« in weniger als zwanzig Friedensjahren ebensoviele Bücher weggeworfen hat, wie im Zweiten Weltkrieg als Verlust verbucht werden mußten.1 Es sind freilich keine historisch neutralen Friedensjahre, sondern es sind Digitalisierungsjahre, wenn man einmal davon ausgeht, daß das, was man »Digitale Revolution« nennt, irgendwann am Ende der 1990er Jahre Fahrt aufzunehmen begann. Und da sich in diesen Digitalisierungsjahren der Trend verstärkt hat, auf die gedruckten Bücher und Zeitschriften als »alte Medien« zu schauen und auf die Digitalia als faszinierend Neues, redet in den Bibliotheken niemand von einer Wegwerf-Katastrophe, sondern alle sind erleichtert, die verstaubten Bände loszuwerden und kilometerweise Regale und damit Stellplatz frei zu bekommen, der, so will es der Zeitgeist, natürlich nicht mit neuen Büchern und Zeitschriften belegt wird, sondern zu aufgeräumt-leeren Sitz- und Arbeitszonen umgewidmet wird.
 [Abb. 6: Aufgeräumte
Bibliothek. Quelle: Pixabay.]
[Abb. 6: Aufgeräumte
Bibliothek. Quelle: Pixabay.]
Die DEALs, die die wissenschaftlichen Bibliotheken derzeit mit den Großanbietern von Fachzeitschriften abschließen lassen, werden diesen Trend ins Ungeheure verstärken. Wie immer bei solchen historischen Trends wird die Wende und das Ende nicht durch vernüftige Worte kommen, sondern dadurch, daß der Trend sich selbst erschöpft und sein Hinkebein — er ist unsagbar teuer, er unterminiert die publizistische Selbstbestimmung der Wissenschaftler, er fördert ein antidemokratisches Kontrollsystem — irgendwann nicht mehr zu übersehen ist. Und dann wird man sich in den Bibliotheken auf die Suche nach dem Weggeworfenen machen, wird Verlustlisten zusammenstellen und auf die digitalwütigen Informationsspezialisten vom Anfang des dritten Jahrtausends schimpfen, die im Rahmen des unausgesprochenen Programms »Podex statt Codex« Regalflächen gegen Sitzflächen tauschten und meinten, sie würden damit die Bibliotheken in eine neue Zeit führen. Aber »Das kann weg!« ist keine Parole, mit der man in Sachen Kultur weit kommt. Die Kultur schaut nämlich nur nach vorne, indem sie zurückschaut, und was sie in der Rückschau sieht, ist, wenn es Kultur ist, wert zu bleiben.
Anmerkung
-
Der Break-Even-Point zwischen Kriegsverlust und Deakzession wurde rechnerisch wahrscheinlich am Ende des Jahres 2017 erreicht, als zu den 24,4 Mio. weggeworfenen Büchern weitere 238883 (2016) und 223605 (2017) Bände dazukamen. Die Zahlen lassen sich in der Deutschen Bibliotheksstatistik leicht verifizieren. Siehe dazu auch Uwe Jochum: Vernichten durch Verwalten. Der bibliothekarische Umgang mit Büchern. In: Verbergen – überschreiben – zerreißen. Formen der Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion. Hrsg. Mona Körte. Berlin: Schmidt, 2007, S. 106-122, hier S. 116 f. ↩
