Reich ist jemand, der viel hat; sei das nun viel von einer Sache oder sei es vielerlei Verschiedenes. Interessant wird der Reichtum allerdings nicht durch das schiere Haben von Sachen, sondern durch die Möglichkeiten, die sich aus dem Haben der Sachen ergeben: Wer viel sein Eigen nennt, kann mit seinem vielen Eigenen auch viel tun, kann andern Menschen Arbeit geben, kann sozial tätig werden, kann in seine Zukunft und die von anderen investieren, kann Künstlern Gelegenheit zum schöpferischen Werk verschaffen und sie dafür sogar fürstlich entlohnen — und er kann es sich bei alldem auch gutgehen lassen inmitten seines Eigentums.
 [Abb. 1:
Die Erschaffung Adams, ein erster Schöpfungsakt aus
Reichtum. Michelangelo hat ihn im Auftrag von Papst Julius
II. nacherschaffen. Rom, Sixtinische Kapelle. Quelle: Jörg
Bittner
auf
Wikipedia.]
[Abb. 1:
Die Erschaffung Adams, ein erster Schöpfungsakt aus
Reichtum. Michelangelo hat ihn im Auftrag von Papst Julius
II. nacherschaffen. Rom, Sixtinische Kapelle. Quelle: Jörg
Bittner
auf
Wikipedia.]
Nun steht natürlich nirgendwo in ehernen Lettern festgeschrieben, wieviel jemand haben kann und haben darf. Über das »Kann« ist nichts zu sagen, weil das von der persönlichen Leistungskraft dieses Jemand abhängt — wenn wir einmal davon absehen wollen, daß es Fälle gibt, in denen Eigentum auf kriminellen Wegen erworben wurde und von Leistungskraft keine Rede sein kann. Über das »Darf« allerdings wurde immer schon viel gesagt und geschrieben, schon deshalb, weil hier schnell der Fall eintritt, daß drei Leute mindestens fünf verschiedene Meinungen darüber haben können, wieviel man überhaupt haben dürfe, alle drei aber der Meinung sein werden, sie hätten erstens das, was sie haben, ganz zurecht, zweitens aber hätten sie nicht genug. Und weil das so ist, kommt man dann ebenso schnell auf die Idee, das Eigentum der einen zu Lasten des Eigentums der anderen zu vermehren.
Daß man so etwas tun könnte oder sogar sollte, ist eine Idee, die von einer anderen Idee mächtig befeuert wird, nämlich der Idee der Gerechtigkeit, Unterabteilung Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva). Das Argument lautet dabei etwa so: Das soziale Ganze sei von höherem Rang als der Einzelne, denn was auch immer ein Mensch tue, er tue es im Rahmen einer Gesellschaft, die ihm die Möglichkeiten gebe, das zu tun, was er tut. Eigentum ist aus dieser Perspektive immer nur gesellschaftlich ermöglichtes und in den von der Gesellschaft gesteckten Grenzen erlaubtes Eigentum. Daher ist das Recht auf Eigentum kein grundständiges Recht der Person, sondern eine Art Gesellschaftsrecht, das die Person als Teil der Gesellschaft miteinbezieht und ihr lediglich im Rahmen dieses Einbezogenseins Eigentum zugesteht. Kurz: Der Staat setzt die Zwecke. Und da der Staat als Kollektiv seiner Bürger gedacht wird, ist es letztlich dieses Kollektiv, das die Zwecke setzt. Der Einzelne als Mitglied des Kollektivs bestimmt dann zwar über die Kollektivzwecke mit, bleibt ihnen aber in jedem Moment nachgeordnet. Und als ein solcher Kollektivzweck, vielleicht als der wichtigste, wird die gerechte Güterverteilung betrachtet.
 [Abb. 2: Phalanstère: Das ideale Produktions-, Wohnungs- und
Sexualkollektiv von 1620 Individuen, erträumt von Charles
Fourier. Quelle: Harvard, Houghton Library (Soc 860.05, Houghton
Library, Harvard University), eingestellt
auf
Wikipedia.]
[Abb. 2: Phalanstère: Das ideale Produktions-, Wohnungs- und
Sexualkollektiv von 1620 Individuen, erträumt von Charles
Fourier. Quelle: Harvard, Houghton Library (Soc 860.05, Houghton
Library, Harvard University), eingestellt
auf
Wikipedia.]
Im modernen Arbeitsstaat kommt es nun zu einer bezeichnenden Erweiterung dieser Idee. Da der Arbeitsstaat die gesellschaftlichen Beziehungen im Hinblick auf den ökonomischen Nutzen betrachtet, der in jedem Moment zu maximieren ist, und zwar durch den Einsatz von immer mehr Technik, tendiert dieses System sehr schnell dahin, den maximalen Nutzen durch maximalen Einsatz von Technik als das bonum commune des staatstragenden Kollektivs zu betrachten. Die Partizipation an diesem bonum commune vollzieht sich dann als maximaler Konsum ebenjener Fülle von Gütern, die mit maximalem Technikeinsatz im Rahmen nutzenmaximierter Produktionsprozesse erzeugt wurden. Eigentum darf dabei nicht stören: Weder darf es bei der Produktion stören, indem es den maximalen Technikeinsatz oder den nutzenoptimierten Herstellungsprozeß behindert (die Eisenbahn wird durch enteignetes Privatland schnurgerade durchgezogen), noch darf es beim Konsum stören, indem es den maximalen Warenabsatz beeinträchtigt (die eingebaute Verfallszeit von technischen Gütern sorgt dafür, daß sie ersetzt werden müssen). Kurzum: Im Kollektiv des Arbeitsstaates wird die gerechte Güterverteilung verstanden als maximale Produktion, Distribution und Konsumtion von Waren, die im gesellschaftlichen Zirkulationsprozeß niemals zu Eigentum gerinnen dürfen, denn nur, wenn sie gleichsam in flüssigem Aggregatzustand bleiben, sind sie als Konsumgut maximal und damit auch scheinbar gerecht verteilbar. In dem Moment aber, da in dem Zirkulationsprozeß sich da und dort Eigentum bildete, würde sich der Fluß der Zirkulation zu verlangsamen beginnen und würde, bei immer mehr gebildetem Eigentum, schließlich erstarren.
Solche Systeme sind unter konsumistischer Perspektive zunächst sehr angenehm. Sie produzieren mehr Waren als andere Systeme, und da sie diese Waren als Kollektivgut verteilen, gibt es auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen den Systemprofiteuren und dem Kollektiv; beide Gruppen scheinen identisch. Und dennoch gibt es Verlierer. Das sind all jene, denen etwas gehört, was dem Kollektiv noch nicht gehört, die also über Eigentum verfügen, das noch kein Kollektiveigentum ist. Sie werden mit derselben Geste enteignet, mit der das Kollektiv ihnen ihren Anteil an den Kollektivgütern zuteilt. Dadurch entsteht insgesamt eine Situation, in der der kollektive Reichtum zunächst anscheinend zunimmt, während der Reichtum in Wahrheit auf Dauer abnimmt: Das Plus auf der Seite des Kollektivreichtums ist ein Minus auf der Seite des Individualreichtums, und sobald der Individualreichtum vollständig sozialisiert ist, wird die Abnahme des gesellschaftlichen Reichtumssaldos Jahr um Jahr sichtbarer. Denn jetzt, wo nichts mehr zu enteignen ist, zeigt sich, daß die Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums nur das Resultat einer kurzen gesellschaftlichen Raubphase war, auf die eine lange Phase folgt, in der die Produktions- und Konsumptionsmaximierung zwar noch den Schein von Reichtum erzeugen kann, hinterrücks aber die Abbauprozesse rasant zunehmen und sich überall eine verkraterte, vermüllte und verdunkelte »Werkstättenlandschaft« (Ernst Jünger) zeigt.
 [Abb. 3:
Hieronymus Bosch: Das Jüngste Gericht, Ausschnitt aus der
Mitteltafel des Triptychons. Quelle:
Quelle:
Wikipedia.]
[Abb. 3:
Hieronymus Bosch: Das Jüngste Gericht, Ausschnitt aus der
Mitteltafel des Triptychons. Quelle:
Quelle:
Wikipedia.]
Wie wenig es sich hier um eine abstrakte Theorie handelt, wird deutlich, wenn man sich die auf den 22. Februar 2017 datierte Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) zum »Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz — UrhWissG)« (Referentenentwurf) anschaut. Wenn die anonymen Autoren der DBV-Stellungnahme schreiben, daß »die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung unabwendbar« sei (S. 1), dann setzen sie nicht nur von vorneherein die Technik über das Recht, dessen Aufgabe offenbar bloß noch als juristischer Nachvollzug technischer Möglichkeiten gedacht wird. Vielmehr ziehen sie damit zugleich das Recht durch die Technik hindurch in die Sphäre der Ökonomie, denn die Verfasser der Stellungnahme schließen sich ohne erkennbares Zögern der von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament vorgegebenen Tendenz an, die Reform des Urheberrechts »zu einem zentralen Baustein der Strategie ›Digitaler Binnenmarkt‹« zu machen (ebd.). Was das heißt, scheint völlig distanzlos und affirmativ klar zu sein: Es gehe, so wird den Lesern erklärt, auf europäischer Ebene darum, »durch wissenschafts- und bildungsfreundlichere Regelungen die Innovationskraft, Kreativität, Wettbewerbsfähigkeit und den besseren Zugang zu Informationen zu befördern.« (ebd.)
Man muß das nicht dreimal lesen, um zu verstehen, daß das exakt jene konsumistische Perspektive ist, von der oben die Rede war: Sie schließt nicht nur Technik und Ökonomie zusammen, sondern beides mit einem kollektivistischen Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit kurz, um über die sich ins Ökonomische steigernde Klimax »Innovation«, »Kreativität« und »Wettbewerb« schließlich beim »Zugang zu Informationen« zu landen. Das Urheberrecht wird damit von einem Recht, das die Urheber (die Innovativen, die Kreativen, die Schöpfer — dieser Begriff fehlt bezeichnenderweise in der DBV-Stellungnahme) schützen will, zu einem Zugriffsrecht des Kollektivs auf die geistigen Schöpfungen der Urheber.
Wie legitimiert man diese juristische Volte, die aus einem freien Verfügungsrecht der Urheber ein Zugriffsrecht des schöpfungskonsumierenden Kollektivs macht? Nun, man legitimiert es, den Referentenentwurf auslegend, auf S. 2 der DBV-Stellungnahme so:
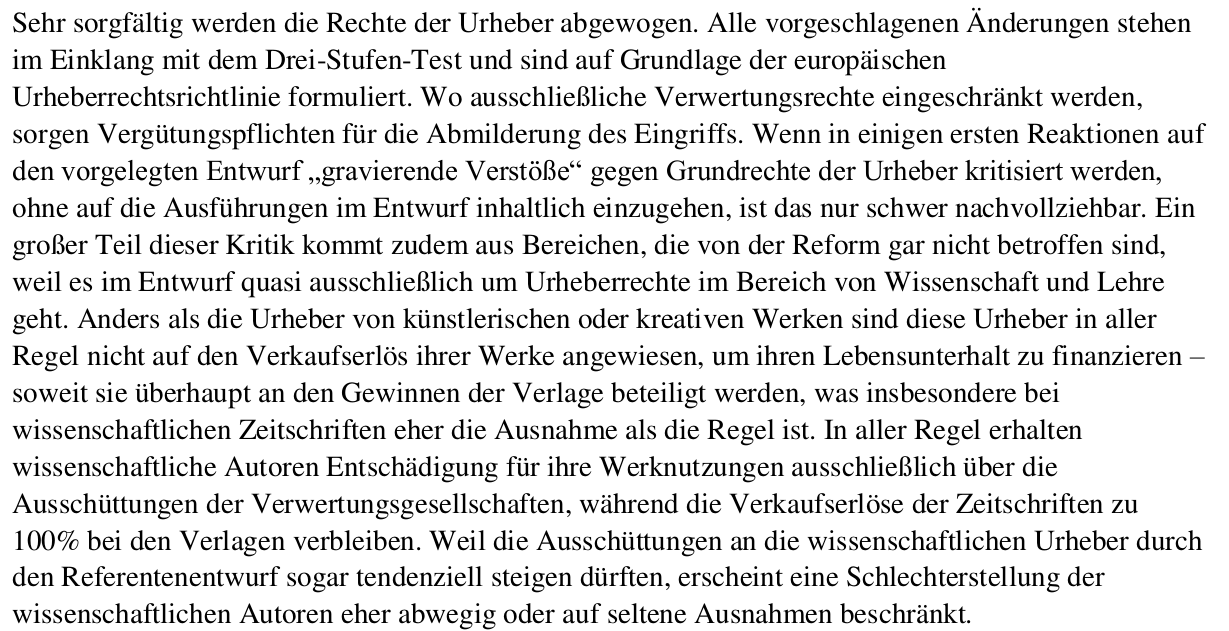
Das ist eine geradezu abenteuerliche Spaltung der Gruppe der Urheber in solche, die mit der angestrebten Urheberrechtsreform gar nichts zu tun hätten — die freien Autoren nämlich, die nicht Angestellte oder Beamte im öffentlichen (Wissenschafts-) Dienst sind —, und solche, die als Wissenschaftler nun zwar von der Rechtsänderung betroffen seien, dies aber verschmerzen könnten, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht durch das wissenschaftliche Schreiben erzielten, sondern durch ihr vom Staat gewährtes Gehalt. Abenteuerlich ist das deshalb, weil das Grundrecht der Kunst-, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit kein Grundrecht nur für einen Teil der Urheber ist, sondern für alle Urheber gleichermaßen gilt. Das ist so, weil die Grundrechte keine vom Staat den Bürgern — allen oder einigen — zugestandenen Rechte sind, die man bei Bedarf auch wieder kassieren könnte; vielmehr sind es Rechte, die den Staat unmittelbar in die Pflicht nehmen; und von der Seite der Staatsbürger sind es Widerstandsrechte gegen den Staat. Mit anderen Worten: Kunst-, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit gehören zu den zentralen grundrechtlichen Stützpfeilern unseres Staates, und zwar als Rechte, die den Umfang staatlicher Aktivitäten beschränken und eine Dominanz des Kollektivs verhindern sollen. Wer diese Pfeiler schwächt oder sie gar abreißen will, betreibt keine Modernisierung unseres Staates, sondern unterminiert ihn.
 [Abb. 4: Mineure in
vom Staat gestellter Uniform bei der Arbeit. Quelle: Brück & Sohn
Kunstverlag Meißen auf
der
Wikipedia.]
[Abb. 4: Mineure in
vom Staat gestellter Uniform bei der Arbeit. Quelle: Brück & Sohn
Kunstverlag Meißen auf
der
Wikipedia.]
Daß sich dank dieser Unterminierung ein höheres Gut verwirklichen lasse — eine gerechte Verteilung von Wissenschaft in Form eines endlich bewerkstelligten freien Konsums von »Informationen« —, ist die Leimrute, mit der die Konsumvögel angelockt werden und auf der sie kleben bleiben sollen. In Wahrheit jedoch geht dabei nicht nur der Staat zum Teufel, sondern mit ihm auch die Gerechtigkeit, Unterabteilung Verteilungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nämlich nur dann zu verwirklichen, wenn ihre drei Komponenten — die gesetzliche Gerechtigkeit (iustitia legalis), die Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa), die Verteilungsgerechtigkeit (iustitia dustributiva) — in ausgeglichener Balance gehalten werden. Was mit einer ausgeglichenen Balance gemeint ist, kommt in den Blick, wenn man sich die einzelnen Komponenten der Gerechtigkeit vor Augen führt und schaut, wie hier das Verhältnis des Einzelnen zum sozialen Ganzen jeweils ausgestaltet wird: Während die iustitia legalis nach dem fragt, was der Einzelne dem sozialen Ganzen des Staates schuldet (ich muß Steuern zahlen, um den Staat am Leben zu erhalten), fragt die iustitia commutativa nach dem, was die Einzelnen einander schulden, wenn sie untereinander in Kontakt treten (ich muß die Rechnung eines Handwerkers bezahlen, dessen Dienste ich in Anspruch genommen habe), und die iustitia distributiva fragt nach dem, was dem Einzelnen von seiten des Staates zusteht (der Schutz des Lebens etwa). Gerecht ist ein Gesetz, gerecht ist staatliches Handeln, gerecht ist das Handeln jedes Einzelnen dann, wenn diese drei Aspekte in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen.
Nun ist es unschwer zu sehen, daß das kollektivistische Verständnis von Gerechtigkeit im Rahmen des Arbeitsstaates die iustitia legalis den beiden anderen Komponenten der Gerechtigkeit überordnet und dabei dem Einzelnen zur Aufgabe macht, durch maximale Produktion und maximalen Konsum von Waren — in unserem Kontext in der Form von »Informationen« — den gesellschaftlichen Zirkulationsprozeß am maximal beschleunigten Laufen zu halten. Dieses Maximum läßt sich nur dann erreichen, wenn der gesellschaftliche Status der Einzelnen möglichst minimiert und ihnen keine Chance eingeräumt wird, außerhalb staatlicher Strukturen und Regulative zueinander in Beziehung zu treten und diese Beziehung eigenverantwortlich zu gestalten. Anders gesagt: Die Maximierung der iustitia legalis benötigt als Korrelat eine Minimierung der iustitia commutativa. Und sie benötigt eine Minimierung der iustitia distributiva, die am einfachsten durch eine Umkehrung ihrer Sinnrichtung erreicht wird: Bei der iustitia distributiva soll es nun nicht mehr um die Frage gehen, was mir von seiten des Staates etwa an Schutz zusteht, sondern darum, was ich zu einer möglichst umfassenden konsumistischen Gleichverteilung der Güter beitragen kann; aus einem Anspruch, den ich an den Staat habe, wird ein Anspruch des staatlichen Kollektivs mir gegenüber.
 [Abb. 5: Konsum mit
Selbstbedienung auf dem Stand von 1960, noch vor dem
Internet. Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-73999-0002 (Weigelt),
via
Wikimedia Commons.]
[Abb. 5: Konsum mit
Selbstbedienung auf dem Stand von 1960, noch vor dem
Internet. Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-73999-0002 (Weigelt),
via
Wikimedia Commons.]
Die Stellungnahme des DBV zeigt diese Minimierung der iustitia commutativa bei gleichzeitiger Umkehr der Anspruchsrichtung der iustitia distributiva in sehr unschöner Weise. So wird in der oben zitierten langen Passage auf S. 2 der Stellungnahme ganz selbstverständlich ausgeführt, die wissenschaftlichen Autoren hätten jenseits der Alimentation, die ihnen als staatlichen (Wissenschafts-) Beamten zusteht, im Grunde keine Ansprüche auf jene Vergütungen anzumelden, die ihnen aus dem Verkauf ihrer Bücher evtl. zuwachsen: Sie seien auf solche Vergütungen zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts »nicht angewiesen«, schreiben die anonymen Autoren der DBV-Stellungnahme; und sie führen aus, wie unerheblich solche Vergütungen, finanziell gesehen, ausfallen können. Das mag aus einem rein ökonomischen Blickwinkel so sein, aber die finanzielle Unerheblichkeit der Vergütung setzt nicht die in dieser Vergütung sich manifestierende iustitia commutativa außer Kraft: daß hier Geschäftspartner — Autoren und Verlage — zueinander in ein freies Tauschverhältnis treten, bei dem über Gabe und Gegengabe so befunden wird, daß der Staat dabei nicht mitzureden hat. Und die Umkehr der Anspruchsrichtung der Verteilungsgerechtigkeit wird sichtbar, wenn die anonymen Autoren des DBV das Gewicht ihrer Stellungnahme nicht nur daraus ableiten, daß sie »im Interesse von Millionen von Nutzern« schreiben, sondern diese Millionen von Nutzern nach Meinung der DBV-Anonymi offenbar über alle partikularen Interessen hinweg das übergeordnete Allgemeine des Staates repräsentieren, so daß es folglich bedauerlich sei, »wenn diese wichtige und ausgewogene Reform [des Urheberrechts] aufgrund von Partikularinteressen scheitern würde.« (S. 2 der Stellungnahme, Beginn des 2. Abs.)
Natürlich kann keine Rede davon sein, daß in der Stellungnahme des DBV durch die Millionen von Bibliotheksbenutzern, in deren Namen man zu sprechen vorgibt, ein höheres Allgemeines repräsentiert werde. Denn zum einen hat der DBV, der ja nichts weiter ist als der Gesamtverband der Bibliotheksverbände und also lediglich das organisierte deutsche Bibliothekswesen vertritt, gar kein Mandat, um für die Benutzer der Bibliotheken zu sprechen. Und zum andern hat der DBV in der Vergangenheit alles getan, um sich als Agent eines einseitig die iustitia legalis betonenden Verständnisses von Gerechtigkeit in ungute Erinnerung zu bringen.[1] Will sagen: Der DBV spricht, wenn er repräsentativ zu sprechen meint, weder für das Kollektiv der Bibliotheksbenutzer (für deren Vertretung er kein Mandat hat) noch für das Kollektiv der Bibliothekare (die für den DBV satzungsgemäß nur von Interesse sein können, wenn sie als Mitglieder der Bibliotheksverbände ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen); er spricht vielmehr aus dem alleinigen Blickwinkel der iustitia legalis und damit aus einem institutionell-staatlichen Blickwinkel: von oben herab und über den Einzelnen hinweg, der für den DBV nur als Informationskonsument überhaupt noch eine Rolle spielt.
Ein einziger Satz bringt das alles auf den Punkt, und es ist ein sehr dunkler Punkt. Als nämlich in der Aktion www.publikationsfreiheit.de sich die von all diesen intendierten Verschiebungen des Urheberrechts betroffenen Urheber selbst zu Wort meldeten und immer noch zu Wort melden — mit derzeit rund 5700 Unterzeichnern —, fiel dem DBV nichts besseres ein als dies: Er lancierte zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz (und damit der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, der die Hochschulrektorenkonferenz als Mitglied angehört) eine gemeinsame Pressemitteilung, in der man die kritischen Äußerungen und Analysen zum Referentenentwurf im besonderen und dem digitalen Umbau der Wissenschaft im allgemeinen nicht nur als »falsche und irreführende Behauptungen« beiseite wischte, sondern die kritischen Äußerungen auch schlicht als Äußerungen eines verlegerischen Partikularinteresses abqualifizierte:
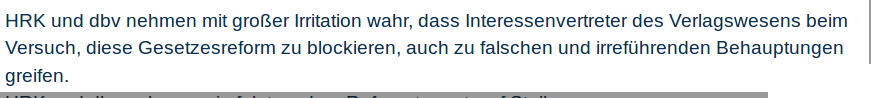
Was man hier mit der Vokabel »Blockade« abtun möchte, ist indessen nicht weniger als das sich über www.publikationsfreiheit.de artikulierende Grundrecht der Kunst-, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, dessen verfassungsmäßige Funktion nun allerdings genau darin besteht, kollektivistische Interessen und Zugriffe zu blockieren: Nur so können die Urheber geschützt werden. Wer ihnen diesen Schutz versagt, wird das kreative Biotop, in dem wir kulturell leben, alsbald in eine Werkstättenlandschaft verwandelt haben, die eines ganz gewiß nicht ist: schöpferisch. Und reich, ja reich wird diese Werkstättenwissenschaft niemanden machen.
 [Abb. 6: Der arme
Wissenschaftler in seiner Werkstatt, vorhergesehen von Carl
Spitzweg. Quelle:
Wikimedia Commons. ]
[Abb. 6: Der arme
Wissenschaftler in seiner Werkstatt, vorhergesehen von Carl
Spitzweg. Quelle:
Wikimedia Commons. ]
Anmerkung
[1]: Hier sei nur an die »Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) zur Anfrage des Bundesministeriums der Justiz vom 19. Februar 2009: Urheberrecht ›Dritter Korb‹« erinnert. Dort heißt es auf S. 6: »Der Deutsche Bibliotheksverband unterstützt den Vorschlag, in § 43 UrhG einen Absatz 2 einzufügen, der eine Anbietungspflicht angestellter Wissenschaftler an ihre Trägerinstitutionen festschreibt.« Gemeint ist damit, daß Wissenschaftler an den Hochschulen die von ihnen hervorgebrachte »wissenschaftliche Literatur und Materialien« auf den »Open-Access«-Servern der Hochschulen »frei zugänglich zu machen« haben (ebd.) — und zwar durch Bereitstellung ebenjenes »Formats«, das der Verlag für den Druck des Beitrags oder Buches verwendet hat: unter Bereitstellung der Druckvorlage als PDF also (S. 5, Abschn. d). (zurück)
