Daß es sich bei »Open Access« um eine »Bewegung« handle, hört und liest man allenthalben, sogar in der Wikipedia. Obwohl das Wort »Bewegung« im Deutschen einen durchaus bedenklichen Beiklang hat, stellen sich viele Anhänger der »Open-Access-Bewegung« taub und glauben, diesmal erblühe in ihrer »Bewegung« so etwas wie eine wissenschaftlich-bibliothekarische Graswurzeldemokratie, die die bestehenden antagonistischen Verhältnisse (die bösen kapitalistischen Verlage mit ihrem Gewinnstreben auf der einen Seite, die gemeinwohlorientierten Wissenschaftler und Bibliothekare auf der anderen Seite) überwinden werde. Würde diese Überwindung gelingen, wäre alles gut, nämlich Wissenschaft insgesamt billiger, demokratisch-»sichtbarer« und »für alle frei zugänglich«. Das Ganze in der sehr einfachen Form, daß alle Interessierten sich übers Internet kostenlos mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen versorgen könnten.
 [Abb. 1: Der große
Akt der Freiheit, in Szene gesetzt mit George Washington,
Benjamin Franklin und Alexander Hamilton. Quelle: Howard Chandler
Christy (Public domain),
via
Wikimedia Commons.]
[Abb. 1: Der große
Akt der Freiheit, in Szene gesetzt mit George Washington,
Benjamin Franklin und Alexander Hamilton. Quelle: Howard Chandler
Christy (Public domain),
via
Wikimedia Commons.]
Natürlich klingt diese Vision einer demokratisch-graswurzeligen Selbstorganisation von Wissenschaft, die obendrein einen für jedermann freien und kostenlosen Zugriff auf wissenschaftliche Publikationen bewerkstelligen will, ganz wunderbar. So wunderbar, daß man nicht nur den Beiklang von »Bewegung« überhört, sondern auch die zahlreichen Bedenken ignoriert, die bislang vorgetragen wurden: daß die »Open-Access«-Sache ganz und gar nicht billig werde, daß sie auf eine verstärkte staatliche Lenkung der Wissenschaft hinauslaufe, daß die Probleme der Demokratie wohl kaum durch »Open Access« aus der Welt zu schaffen seien. In den Augen der von »Open Access« Bewegten sind das Mäkeleien, die weder die Wünschbarkeit noch die Machbarkeit von »Open Access« in Frage stellen.
Nun ist es mit den großen Visionen freilich so eine Sache. Man kann sich da sehr leicht visionär übernehmen, um eines Tages erstaunt festzustellen, daß das, was man für Mäkeleien hielt, nichts anderes als der Widerstand der Realität war, an der sich die Vision allmählich aufzureiben beginnt. Man kann sich aber auch darin visionär vertun, daß man etwas für eine wunderbare Vision hält, was in Wahrheit ein böser Dämon ist, der sich ein schickes Kleid übergezogen hat. Ich fürchte, bei »Open Access« ist genau das der Fall.
Wer einen Blick auf den Dämon werfen will, der sich unter dem »Open-Access«-Kostüm verbirgt, tut gut daran, sich zunächst noch einmal die Entstehung der »Open-Acess«-Bewegung zu vergegenwärtigen. Sie begann öffentlichkeitswirksam – nach einer im Dezember 2001 in Budapest veranstalteten Tagung mit ganzen fünfzehn Teilnehmern – mit einer im Februar 2002 in Budapest verabschiedeten und bis heute bewegungstragenden Erklärung. In ihr klingt all das an, was die Debatte um »Open Access« seither prägt: Auf der einen Seite die Forderung, das wissenschaftliche Publikationswesen von bedrucktem Papier aufs Internet umzustellen, um einen möglichst billigen, niedrigschwelligen und ubiquitären Zugriff auf wissenschaftliche Informationen zu erreichen und damit auch das Wissenschaftsgefälle zwischen reichen und armen Ländern abzubauen — und auf der anderen Seite die Forderung, zu diesem Zweck das Urheberrecht im Grunde auf ein Zitationsrecht zu beschränken, also darauf, daß die wissenschaftlichen Autoren »ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert« finden, wie es in der »Budapester Erklärung« heißt. Die mit dem Urheberrecht verbundenen Verwertungsrechte der Autoren hat man also schon damals in Budapest kupiert, indem man gleich im ersten Satz der Erklärung von einer alten Tradition sprach, die darin bestehe, daß Wissenschaftler »die Ergebnisse ihres Arbeitens in Fachzeitschriften […] veröffentlichen und diese Veröffentlichungen anderen zur Verfügung […] stellen, ohne hierfür bezahlt zu werden.« Damit, so schien es, war man der bösen Ökomonie enthoben und durfte sich der Ausgestaltung eines guten, nämlich ökonomiefreien wissenschaftlichen Publikationswesens widmen, in dem, wenn »Open Access« durchgesetzt würde, eines Tages die Wissenschaftspublikationen so von den Wissenschaftsbäumen fielen, wie sonst nur im Schlaraffenland die Brathendl: ganz von alleine, ohne alle Mühe, und kostenlos sowieso.
 [Abb. 2: Der Beginn
von »Open Access«, in Budapest im Dezember 2001 in Szene gesetzt,
u.a. mit Peter Suber (Dritter von rechts) und Stevan Harnard
(Zweiter von links, leicht verdeckt). Quelle: Lesliekwchan
via
Wikimedia Commons.]
[Abb. 2: Der Beginn
von »Open Access«, in Budapest im Dezember 2001 in Szene gesetzt,
u.a. mit Peter Suber (Dritter von rechts) und Stevan Harnard
(Zweiter von links, leicht verdeckt). Quelle: Lesliekwchan
via
Wikimedia Commons.]
Aber die böse Ökonomie saß damals in Budapest mitten am Tisch. Man wollte sie nur nicht wahrhaben und redete sich schön, was man nicht wahrhaben wollte. Man redete sich schön, daß die Budapester Tagung von George Soros und seinem »Open Society Institute« (OSI) initiiert worden war und das OSI die »Bewegung« mit einer Starthilfe von 3 Mio. US-Dollar ausgestattet hatte. Das war Geld, das Soros in der bösen Realökonomie verdient hatte, und er hatte es verdient mit Insiderhandel und Geschäften, bei denen er ganz offen gegen die Währungen demokratischer Staaten spekulierte. Man mag so etwas für clever halten, und man mag George Soros glauben wollen, daß er mit solchen Spekulationsgeschäften politökonomische Entwicklungen stoppen wollte, die er für fatal hielt (und hält, denn er spekuliert immer noch). So gesehen mag man dann George Soros für einen Philanthropen und politischen Aufklärer halten und die in die »Open-Access-Bewegung« gesteckten Gelder für so etwas wie eine wiederangelegte Spekulationsrendite zwecks Erzielung eines Aufklärungsgewinns. Man kann das alles aber auch für einen einfachen Fall von Hybris halten, bei dem ein Einzelner sich anmaßt, demokratisch gewählten Regierungen zu zeigen, wo Bartel den Most holt; nämlich beim guten Georg. Und damit das auch auf dem weiten Feld der Wissenschaft jeder versteht, nimmt man 3 Mio. US-Dollar in die Hand und stellt ein OSI als »Gründungsnetzwerk« auf die Beine, das »seine Ressourcen und seinen Einfluss geltend machen [wird], um institutionelle Bemühungen des Self-Archiving weiter zu fördern und um bei der Gründung alternativer Zeitschriften und bei deren Bemühen um finanzielle Sicherung zu helfen. Doch auch wenn das Engagement und die Mittel des Open Society Institute eine unabdingbare Voraussetzung sind, um die nächsten Schritte vollziehen zu können, braucht unsere Initiative dringend weitere Organisationen, die uns mit ihrem Engagement und mit ihren Ressourcen unterstützen.«
 [Abb. 3: George Soros
applaudiert. Quelle: World Economic Forum, 2010, Sebastian
Derungs
via
Wikimedia Commons.]
[Abb. 3: George Soros
applaudiert. Quelle: World Economic Forum, 2010, Sebastian
Derungs
via
Wikimedia Commons.]
So steht es am Ende der »Budapester Erklärung«, und niemand wird heute noch daran zweifeln, wie gut es George Soros und seinem OSI gelungen ist, aus ihren finanziellen Ressourcen und aus ihrem Einfluß tatsächlich auch politisches Kapital zu schlagen. Denn kaum hatte man aus Budapest den Startschuß zu »Open Access« gehört (zu Beginn des Jahres 2002), kaum hatte man in Bethesda (im amerikanischen Bundesstaat Maryland) unter Beteiligung eines OSI-Repräsentanten ein »Statement« verabschiedet (im Frühjahr 2003), in dem man die »Open-Access«-Sache direkt zu einer Sache der Wissenschaft und ihrer Organisationen erklärte, als auch schon in Deutschland die großen Wissenschaftsorganisationen auf den »Open-Access«-Zug aufsprangen und in Berlin eine »Erklärung« verabschiedeten (im Oktober des Jahres 2003), die sich optisch im Stil der Verfassung der Vereinigten Staaten präsentierte und »Open Access« ganz offiziell und mit Aplomb auf die Agenda der deutschen Wissenschaftspolitik setzte.
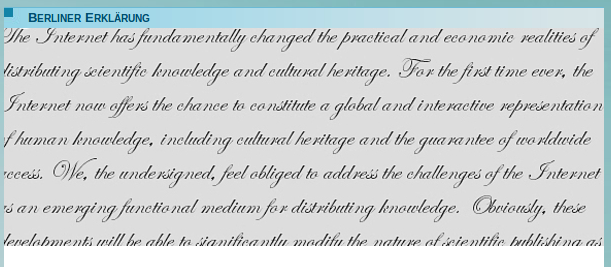 [Abb. 4:
Die Berliner Erklärung im Layout
der
amerikanischen Verfassung. Quelle:
Max-Planck-Gesellschaft.]
[Abb. 4:
Die Berliner Erklärung im Layout
der
amerikanischen Verfassung. Quelle:
Max-Planck-Gesellschaft.]
Diese Agenda war zunächst reichlich in Watte gepackt. Man sprach in der »Berliner Erklärung« davon, daß man das »Open-Access«-Anliegen »fördern« wolle, und man wollte die Akteure gerne zu »Open Access« »ermuntern« — aber schon damals war klar, daß in dieser weichen Förder- und Ermunterungswatte ein stacheliger Kern steckte. Nämlich ebenjener Kern, den man in Budapest der »Open-Access«-Bewegung mit auf die Reise gegeben hatte: die Umstellung des wissenschaftlichen Publikationswesens aufs Internet unter Reduktion des Urheberechts auf ein reines Zitationsrecht — und das à la Soros unter Gebrauch des dafür notwendigen Einflusses, weshalb man auch gleich auf notwendige Maßnahmen sann, die »von Entscheidungsträgern, Forschungsorganisationen, Förderinstitutionen, Bibliotheken, Archiven und Museen zu bedenken sind.« (»Berliner Erklärung«, S. 1) Solchermaßen sich selbst und die von ihnen finanziell abhängigen Wissenschaftseinrichtungen auffordernd (»zu bedenken sind«, imperativisch), gingen die deutschen Wissenschaftsorganisationen dann auch sehr konsequent dazu über, das, was sie fördern wollten, über eine sehr einfache Maßnahme umzusetzen: Per Förderrichtlinie verlangten sie von den Geförderten, daß diese all das, was sie in geförderten Projekten publizierten, »Open-Access«-konform publizierten.
Was anfangs eine weiche Förderrichtlinie war, verhärtete sich allmählich zu einer alternativlosen Vorgabe, bis man nach fünfzehn aktivistischen »Open-Access«-Jahren die Zeit gekommen sah, die alternativlose Vorgabe auch endlich Gesetz werden zu lassen: Im März 2014 führte man in Baden-Württemberg ein neues Hochschulgesetz ein, das den Universitäten die vom Gesetzgeber mehr als nur gewünschte Möglichkeit gab, per Satzung den Universitätswissenschaftlern ein »Open-Access«-konformes Publizieren verpflichtend vorzuschreiben (LHG, § 44, Abs. 6). Das ließ man sich an der Universität Konstanz nicht zweimal sagen und verabschiedete flugs die gewünschte Satzung, mit der Folge, daß die Konstanzer Juristen ihre eigene Universität vor den Kadi zogen — wegen des starken juristischen Verdachts, hier werde in die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit eingegriffen und also ein Grundrecht mißachtet.
So sieht es also aus, wenn man sich auf den Weg zu »Open Access« macht und den (wissenschaftlichen) Autoren ein »Open-Access«-konformes Veröffentlichen vorschreibt: Man kann das nur erreichen, wenn man die urheberrechtliche Verfügungsgewalt der Autoren über ihre Texte beschneidet und das Urheberrecht so umbaut, daß zuletzt die Bibliotheken, Archive und Museen darüber bestimmen können, in welcher medialen Gestalt ein (wissenschaftliches) Werk aufzubewahren und weiterzuverarbeiten sei (wie es der Referentenentwurf für das neue »Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz« vorsieht, dort § 60e). Das ist die innere Logik von »Open Access«, eine Logik, die die »Open-Access«-Bewegung von Budapest über Bethesda und Berlin bis Konstanz antreibt und Wissenschaftsfreiheit mit einer völlig libertären Nutzung von (wissenschaftlichen) Werken verwechselt, von Werken, die nicht mehr in ihrer vom Autor gewollten Integrität interessieren, sondern nur noch als Spielmaterial für das, was man jetzt »Nachnutzung« nennt: die beliebige mediale Verwurstung des von einem Autor gelieferten »Content«.
 [Abb. 5: Hardware
für»Open Access«. Quelle: Seydelmann (D. Graeber)
via
Wikimedia Commons.]
[Abb. 5: Hardware
für»Open Access«. Quelle: Seydelmann (D. Graeber)
via
Wikimedia Commons.]
Wer’s immer noch nicht glauben mag, schaue sich einfach nocheinmal den Text der »Budapester Erklärung« an oder das, was in der »Berliner Erklärung« auf S. 2 steht: »Die Urheber und die Rechteinhaber solcher [wissenschaftlicher] Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.«
Das ist in Kurzform die mehr oder weniger bekannte Geschichte von »Open Access«. In ihr fehlt freilich ein wesentliches Moment: das reale institutionelle Fundament, auf dem die »Bewegung« aufruht und das die »Bewegung« in die Lage versetzt, sich überhaupt zu bewegen. Denn für eine »Bewegung« genügt es nicht, daß irgendjemand eine »Bewegung« will (die »Allianz der Wissenschaftsorganisationen« etwa), es müssen auch die Organe vorhanden sein, die die »Bewegung« ausführen. Schauen wir uns also den Aufbau des Bewegungsfundaments oder der Bewegungsorgane an, wie er von 2001 bis heute erfolgte und immer noch erfolgt.
Dieser Aufbau begann im Jahre 2004 mit der »Göttinger Erklärung« des »Aktionsbündnisses ›Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft‹«, in dem die Synthese von digitaler Transformation des wissenschaftlichen Publikationswesens und Schleifung des Urheberrechts die Gestalt eines Vereins annahm, der in einer großangelegten Unterschriftenaktion über 7000 Personen fand, die das »Open-Access«- und Urheberrechtsänderungsanliegen unterstützten. Diese Vereinsgründung suggeriert so etwas wie Selbstbestimmung, und die Suggestion wird verstärkt durch die 7000 Unterzeichner der vom »Aktionsbündnis« auf den Weg gebrachten »Göttinger Erklärung«. Schaut man sich freilich das Innenleben des Vereins an, sieht man auf einen Blick, daß die Wissenschaftsorganisationen, Fachverbände und Universitäten nicht nur als institutionelle Unterzeichner der »Göttinger Erklärung« auftraten, sondern mehrheitlich auch die »Lenkungsgruppe« des »Aktionsbündnisses« stellten und stellen:
 [Abb. 6:
In Göttingen inszeniert sich das »Aktionsbündnis«: Die
Lenkungsgruppe (Stand Juni
2017). Quelle:
Website des Aktionsbündnisses.]
[Abb. 6:
In Göttingen inszeniert sich das »Aktionsbündnis«: Die
Lenkungsgruppe (Stand Juni
2017). Quelle:
Website des Aktionsbündnisses.]
Damit hätte eigentlich schon an dieser Stelle klar sein können, daß die vom »Aktionsbündnis« inszenierte graswurzelige Selbstorganisation von Wissenschaft nur ein Schein war und die Wissenschaftsorganisationen als die eigentlichen Akteure im Hintergrund die Fäden zogen. Und es hätte ebenso klar sein können, daß es sich hier nicht um die Organisation der urheberrechtlichen Bedürfnisse von (Wissenschafts-) Autoren handelt, sondern um die Organisation der Verwertungs- und Nutzungsinteressen vornehmlich der Bibliotheken, die ihre Bedürfnisse zu den Bedürfnissen von Wissenschaft schlechthin zu stilisieren versuchten und immer noch versuchen.
Immerhin zeigt der juristische Mantel eines Vereins, wie sehr man in dieser frühen Phase der Fundamentlegung noch daran interessiert war, einen Hauch von Selbstorganisation zu verströmen. Kaum war man sich aber seiner Sache sicherer geworden, konnte man diesen Hauch verwehen lassen und griff direkt in die Schatzkiste der vom Bund über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellten Fördermittel: Im Jahre 2006 stellte man bei der DFG einen Antrag auf Förderung des Projektes »Wissenschaftspolitische Vernetzung und Internationalisierung der Informationsplattform open-access.net«, bei dem es, wie der Projektname schon sagt, nicht um die Förderung von Wissenschaft ging (die eigentliche Aufgabe der DFG), sondern um die Förderung von Wissenschaftspolitik im Sinne der DFG (offenbar eine von der DFG gerne miterledigte uneigentliche Aufgabe). Die DFG ließ sich nicht lumpen und genehmigte diesen Antrag prompt. Und so konnte ein Jahr später (2007) DFG-gefördert die »Informationsplattform open-access.net« ans Netz gehen und bis heute das tun, wozu sie erfunden wurde und wozu sie mit einer unbekannten Geldsumme finanziert wird (wenn auch inzwischen nicht mehr ausschließlich von der DFG, sondern von der DFG, dem Land Baden-Württemberg, der Hochschulrektorenkonferenz, der Volkswagenstiftung und einigen anderen Akteuren auf dem Feld der Hochschulpolitik und -finanzierung): Sie »informiert« nicht nur über »Open Access«, sondern sie organisiert »Open Access« auch dadurch mit, daß sie »Open-Access-Tage« ausrichtet, um über eine Vernetzung der Akteure die »Open-Access«-Sache weiter voranzubringen. Und das geschieht, wie man versichert, von Jahr zu Jahr mit steigendem Erfolg.
 [Abb. 7: Projektpartner und Förderer von
»open-access.net«: Bildschirmphoto; das animierte Original zeigt
alle Unterstützer. Quelle:
Website »open-access.net«.]
[Abb. 7: Projektpartner und Förderer von
»open-access.net«: Bildschirmphoto; das animierte Original zeigt
alle Unterstützer. Quelle:
Website »open-access.net«.]
Das Fundament für »Open Access« wäre allerdings nicht vollständig gelegt, wenn man sich nicht gleichzeitig organisatorisch darum gekümmert hätte, das bestehende Urheberrecht als antiquiert zu brandmarken und einem neuen Urheberrecht, das die Konsumenten von Texten über ihre Produzenten setzt, den Weg zu bahnen. Zu diesem Zweck griff man wieder in die DFG-Schatzkiste und stellte den Antrag auf Finanzierung des Aufbaus einer »Informationsinfrastruktur zum Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft«, die alsbald als »iuwis« eine DFG-genehmigte Gestalt annahm. Damit hatte man eine Plattform im Netz, die, wie es auf der Website heißt, »Debatten, Entwicklungen, Rechtsprechung und Gesetzgebung zum Urheberrecht in Wissenschaft und Bildung begleiten« sollte, diese »Begleitung« aber natürlich als Dauerverkündigung eines notwendigerweise zu ändernden Urheberrechts begriff — inkl. einer Dauerkritik an all denen, die diese Notwendigkeit nicht sahen und nicht sehen. Daß die DFG-Finanzierung von »iuwis« 2011 auslief — auch hier ist die verbrauchte Fördersumme unbekannt —, ist dabei insofern kein Schaden, als sich nun der »Aktionsbündnis«-Verein um den Weiterbetrieb von »iuwis« kümmert
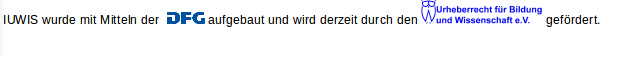 [Abb. 8:
Förderer von
»iuwis«. Quelle:
Website »iuwis.]
[Abb. 8:
Förderer von
»iuwis«. Quelle:
Website »iuwis.]
und niemand ein Problem damit hat, daß der »iuwis«-Server von der Universität Oldenburg betrieben wird. Warum auch: Über das »iuwis«-fördernde »Aktionsbündnis« sitzt ja sowieso die deutsche Wissenschaftsbürokratie mit am Tisch, und also bleibt auch unter neuer Förderadresse alles beim alten, nämlich der großzügigen staatlichen Förderung von »Open Access«, seiner Propagierung durch staatliche finanzierte Organisationen und Vereine und zuletzt seiner zwangsweisen Durchsetzung.
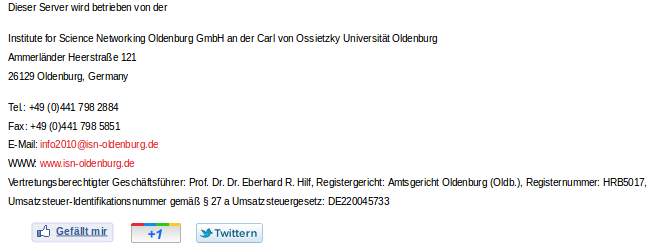 [Abb. 9:
Der Server von »iuwis« steht in
Oldenburg. Quelle: Website »iuwis«.]
[Abb. 9:
Der Server von »iuwis« steht in
Oldenburg. Quelle: Website »iuwis«.]
Das ist der Weg, den »Open Access« über die vergangenen fünfzehn Jahre genommen hat. Es ist mitnichten der Weg einer sich selbst organisierenden graswurzeldemokratischen »Bewegung«, die aus der Wissenschaft kam und durch ihre übergroße Attraktivität rasch Anhänger fand. Vielmehr ist es ein von der Wissenschaftsbürokratie mit staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe — alleine das »Open-Access«-bewegte Personal dürfte den Steuerzahler zwischen 8 und 16 Mio. Euro im Jahr kosten — und zuletzt mit offenem Zwang gebahnter Weg. Es ist ein Weg, auf dem die Interessen der Wissenschaftsbürokratie, der ihr unterstehenden Bibliotheken und — das signalisiert der Name George Soros[1] — eines in diesen Zonen um sich greifenden liberalistischen Verständnisses von Wissenschaft durchgesetzt werden sollen, das von den Wissenschaftler nichts weiter als die Lieferung von beliebig weiterverarbeitbarem »Content« erwartet und von ökonomisch möglichst rasch auszuschlachtenden Resultaten.
[Abb. 10: Ganz offene
Durchsage an die Reisenden in Sachen Wissenschaft: Alle müssen
jetzt hören. Quelle: EveryPicture
via
Wikimedia Commons.]
[1]: Dazu mein Artikel »Digitale Wissenschaftskontrolle« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 23. November 2016, S. N4. (zurück)
