Wir alle haben die Geschichte schonmal gehört, manchmal in mehreren Auflagen: Da sitzt ein chinesischer Austauschstudent an einem naturwissenschaftlich-technischen Institut irgendeiner deutschen Universität, und in langen Nachtschichten saugt er aus den dort verfügbaren Datenbanken soviel er nur kann, um die Daten — bibliographische Informationen, PDFs von Fachartikeln, Statistiken — hernach per E-Mail an seine Freunde in China zu verschicken. Das ist möglicherweise so etwas wie die Rache der Zweiten an der Ersten Welt: Man nutzt die moderne digitale Infrastruktur, um dem alten Gegner aus der Zeit des Boxeraufstandes soviel an Daten abzuluchsen wie möglich, Daten, mit denen sich China dann auf den Sprung machen kann, von der Zweiten in die Erste Welt. In China wird das jeder mögen, und man wird Lob ernten; in Deutschland mag man das weniger, da ist das, wie in andern Ländern auch, verboten: Die Datenbankanbieter lassen im Hintergrund Protokolldateien mitlaufen und stellen recht schnell fest, wo da im Netz jemand Daten absaugt, die quantitativ weit jenseits dessen liegen, was ein einzelner Wissenschaftler zur Not zur Kenntnis nehmen kann (und was von der jeweiligen Universität bezahlt wurde); und dann wird die ganze Uni gesperrt, aus deren IP-Kreis der Sauger auf die Daten zugegriffen hat; wenn man Glück hat, trifft die Sperre nur das Institut oder den Lehrstuhl. In jedem Fall aber entspricht die Freude unserer chinesischen Freunde ob der Daten kaum dem Ärger unserer deutschen Institute und Universitäten ob des Verstoßes gegen die Nutzungsrechte der Datenbanken.
 [Abb. 1:
Boxeraufstand 1900/1901. Quelle: Wikimedia Commons, Public
Domain.]
[Abb. 1:
Boxeraufstand 1900/1901. Quelle: Wikimedia Commons, Public
Domain.]
Man kann es natürlich auch so machen wie die deutsche Industrie: Man kooperiert mit chinesischen Firmen, und als Preis für die Kooperation muß man sein technisches Wissen mit dem chinesischen Partner teilen, der dafür dann der ausländischen Firma Zugang zum chinesischen Markt gewährt. Das verspricht schönste Geschäfte auf dem weltgrößten Markt, aber leider leider: Der chinesische Partner nimmt das aus Deutschland gelieferte Wissen samt der Patente und bastelt daraus dann ein eigenes Produkt, das anfangs noch ein wenig wackelig daherkommt, bald aber dem deutschen Produkt in nichts nachsteht. Und dann produziert der chinesische Partner an seinem deutschen Partner vorbei, daß es eine Lust ist: chinesische Hochgeschwindigeitszüge, die haargenau so aussehen wie ein deutscher InterCity, chinesische Flugzeuge, die haargenau so aussehen wie ein europäischer Airbus, chinesische Autos, die haargenau so aussehen wie eines der Fahrzeuge aus Wolfsburg, Stuttgart oder München. Und sie sehen nicht nur so aus, sie funktionieren auch so, und zwar immer besser; nur daß sie erheblich billiger sind und China mit ihnen den Weltmarkt aufzurollen beginnt.
Das alles ist teils illegal, teils unangenehm, und für den deutschen Steuerzahler immer teuer. Denn er ist es, der zuletzt die Zeche dafür zahlt, wenn an einer deutschen Universität nach großen Datenabsaugaktionen die Datenbankanbieter die Preise für ihre Erzeugnisse nicht unbedingt senken; und er zahlt natürlich dafür, wenn in Deutschland die Geschäfte von Geschäftspartnern chinesischer Firmen schlechter zu gehen beginnen: dann wird entlassen (eingestellt wird in China), dann läßt sich weniger an Steuern abschöpfen (die Steuerabschöpfung findet in China statt), dann läßt sich auch weniger investieren (in China dafür um so mehr); und dann wird aus dem hierzulande gewohnten innovativen Blick in die Zukunft ganz schnell ein melancholisches Starren auf die vergangenen besseren Zeiten.
[Abb. 2:
InterCity CRH3 made in China. Quelle: wiki05, Wikimedia
Commons, Public Domain.]
In Zukunft freilich können sich unsere chinesischen Freunde die Sache viel einfacher machen. Denn in Zukunft braucht es keine studentischen Nachtschichten mehr und auch keine komplizierten Kooperationsverträge, um an deutsches Know-How zu kommen. In Zukunft wird »Open Access« dafür sorgen, daß sich die Welt bei uns frei und kostenlos geistig bedienen kann, um dann mit dem von uns Gedachten und Gemachten eigene Geschäfte anbahnen zu können. »Open Access«, wir erinnern uns, ist ja der Versuch, diejenigen fürs elektronische Publizieren von wissenschaftlichen Artikeln zur Kasse zu bitten, die überhaupt etwas gedacht und dann das Gedachte auch aufgeschrieben haben, um es sodann als Veröffentlichung an die Frau und den Mann zu bringen. Wenn also eine Universität, wenn ein Land viel an Wissenschaftlichem zu veröffentliche hat, dann wird das alles von der jeweiligen Universität oder dem jeweiligen Land über umverteilte Steuermittel bezahlt, um es hernach kostenlos »ins Netz« zu stellen und weltweit verfügbar zu machen. Man macht das, weil man glaubt, beim elektronischen Publizieren billiger davonzukommen als es im bisherigen System der gedruckten Abonnementszeitschriften möglich war; und man macht es, weil man glaubt, daß dann, wenn alle Staaten bei »Open Access« mittun, auch alle etwas davon haben werden: Die USA bekommen übers Netz kostenlos die deutschen Beiträge zur Wissenschaft, Deutschland dito die amerikanischen — und so für weltweit alle Länder, in denen Wissenschaft betrieben wird; das wäre, wenn es denn klappen würde, so etwas wie ein weltweites Geben und Nehmen, ein globaler Wissenschaftspotlatch.
Das ist die Theorie.
Die Praxis sieht freilich ganz anders aus.
 [Abb. 3: »Open
Access« in Form eines Potlatchs der Klallam in Port Townsend,
Washington, USA. Quelle: Wasserfarbenzeichnung von James
Gilchrist Swan (1818–1900), Wikimedia Commons, Public Domain.]
[Abb. 3: »Open
Access« in Form eines Potlatchs der Klallam in Port Townsend,
Washington, USA. Quelle: Wasserfarbenzeichnung von James
Gilchrist Swan (1818–1900), Wikimedia Commons, Public Domain.]
In der Praxis heißt »Open Access«, daß die besonders wissenschaftspublikationsfreudigen Universitäten und Staaten — nennen wir sie die »Produktiven« — alle jene, die weniger publikationsfreudig sind — nennen wir sie die »Rezeptiven« —, wissenschaftlich aushalten. Die Rezeptiven bekommen von den Produktiven die produktive Wissenschaft frei Haus geliefert, ohne sich an den Kosten auch nur mit einem Quentchen Geld beteiligen zu müssen, was sie aber mit Sicherheit nicht daran hindern wird, das kostenlos Rezipierte in schöne technische Anwendungen und Produkte umzugießen. Die werden freilich, siehe oben, billiger sein als die Anwendungen und Produkte der Produktiven, aus dem einfachen Grund, daß die Rezeptiven sich einen großen Teil der Entwicklungskosten sparen können — die haben sie, wenn man so will, sehr erfolgreich in die produktive Erste Welt ausgelagert, die für die Rezeptiven nicht nur mitdenkt, sondern auch gleich noch kostenlos mitveröffentlicht.
Es ist dieser in »Open Access« eingebaute Umschlagspunkt, an dem die Produktiven zu Rezeptiven und die Rezeptiven zu den neuen Produktiven werden, woran die Sache scheitern wird. Denn dieser Umschlagspunkt markiert einen doppelten Salto ins Verantwortungslose. Zum einen nämlich macht »Open Access« das wissenschaftliche Publizieren in den produktiven Industrienationen deutlich teurer als das bisherige Veröffentlichungssystem; und zum andern entläßt »Open Access« die möglichen Interessenten von Wissenschaft — seien die an anderen Universitäten, in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten zu finden, seien es Privatiers oder Industriebetriebe — aus der Verantwortung, sich am wissenschaftlichen Publikationssystem finanzierend zu beteiligen. Statt dessen ermöglicht es den reinen anwendungsbezogenen Verwertern von Wissenschaft, das von andern bezahlte Publikationssystem zu nutzen, ohne einen Gedanken daran verschwenden zu müssen, daß sie auf ein komplexes und teures System von wissenschaftlichen Einrichtungen und Medien zugreifen, zu dem sie eigentlich einen finanziellen Beitrag leisten sollten. »Open Access« schenkt ihnen diesen Beitrag und erklärt das wissenschafliche Publikationssystem zu einer Angelegenheit alleine der Steuerzahler. Und da das Steuerzahlen eine nationale Angelegenheit ist, dürfen alle, die jenseits der Landesgrenze sitzen, sich hemmungslos bedienen, ohne zur Kasse gebeten zu werden: der einfache Privatmann ebenso wie der international agierende Großkonzern mit Sitz in Irland oder auf den Bermudas. Man kann sich ausrechnen, daß ein wissenschaftliches Publikationssystem, das die Profiteure von Wissenschaft aus der Finanzierung entläßt und die Kosten des Systems alleine dem Steuerzahler aufbürdet, allmählich den finanziellen Ast, auf dem es sitzt, absägen wird. Denn man wird irgendwann feststellen, daß im »Open-Access«-Publikationssystem das Geld auszugehen beginnt (es fehlt ja die Industrie und es fehlt das Ausland als Ko-Finanziers); und irgendwann wird sich der deutsche Steuerzahler und Wähler fragen, warum er mit seinem Geld an den deutschen Universitäten eine Chemie und eine Biologie finanziert, deren Resultate in den USA von Monsanto kostenlos, aber gewinnbringend »verwertet« werden dürfen.
Ich weiß wirklich nicht, was passieren würde, wenn jemand sich die Mühe machen sollte, diese Zusammenhänge einem Donald Trump zu erklären. Ich fürchte, daß dann das ganze schöne »Open-Access«-Konstrukt über Nacht zusammmenbricht. Denn sobald Donald Trump verstanden hat, daß »Open Access« eine Methode ist, bei der die amerikanischen Steuerzahler den Löwenanteil der Weltwissenschaft finanzieren — jedenfalls den Publikations-»Output« von Wissenschaft —, ohne auch nur annähernd eine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten… — tja: Dann dürften die kostenlosen amerikanischen Volltextserver fürs Ausland schneller unerreichbar sein als es sich unsere »Open-Access«-Jünger ausmalen können.
Aber nein, sagt mir meine »Open-Access«-begeisterte Bekannte aus einer norddeutschen Tieflandsbibliothek. Das mit den Kosten, sagt sie, siehst Du zu eng, viel zu eng, denn es geht bei »Open Access« ja auch darum, daß die Dritte Welt in die Lage versetzt wird, an europäischer oder westlicher Wissenschaft partizipieren zu können. Das ist, so sagt sie mir, eine Art Ausgleich für erlittenes Unrecht während der Kolonialzeit bzw. für anhaltende Ausbeutungsstrukturen, die wir zu verantworten haben. Wir geben also, so das Argument, in Form von kostenlosen und »im Netz« verfügbaren wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Dritten Welt zurück, was wir ihr moralisch schulden: Wir integrieren sie wenigstens auf diesem Wege in die Erste Welt. Und wir schaffen damit Entwicklungschancen. Das, so sagt meine Bekannte, rechtfertige die Mehrkosten von »Open Access« allemal.
Meine Bekannte steht mit dieser Meinung keineswegs alleine da. Kein geringerer als Kofi Annan hatte schon im Jahre 2002 verkündet, daß die modernen »Informations- und Kommunikationsmedien« das Potential hätten, ökonomisches Wachstum zu fördern, Armut zu bekämpfen und die Integration der Entwicklungsländer in die Weltökonomie zu fördern. Und zehn Jahre später, 2012, war der britische Guardian der Meinung, die Wissenschaftler in den Entwicklungsländern seien »die größten Nutznießer« von »Open Access« — das ja, wie man ergänzen muß, als Digitalmedium eben jenes technische Potential ausspielt, von dem Kofi Annan gesprochen hatte. Ein digitaltechnisches Potential, das schließlich in der Dritten Welt zur Reduktion der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit der Mütter, einem Rückgang von HIV, Malaria und anderen Seuchen und einer Verbesserung der Umweltbedingungen führen werde, weltweit insgesamt sogar zu einer besseren Entwicklungspartnerschaft, wie man in Issues schrieb, einem (digitalen) Magazin, das sich wissenschaftspolitischen Fragen widmet:
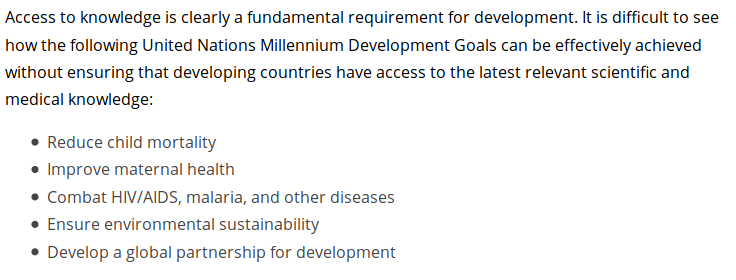 [Abb. 4: Issues rettet die Entwicklungsländer
durch »Open Access«. Quelle: Issues 24/2, Winter
2008.]
[Abb. 4: Issues rettet die Entwicklungsländer
durch »Open Access«. Quelle: Issues 24/2, Winter
2008.]
Das sind, um es vorsichtig zu sagen, ehrgeizige politische Ziele, und es sind Ziele, die man offenbar dadurch erreichen will, daß man die Publikationstechnik vom Papier auf Digitales umstellt. Ich habe noch niemanden getroffen, der der Meinung ist, die Einführung der Schreibmaschine am Ende des 19. Jahrhunderts habe das preußische Dreiklassenwahlsystem überwinden helfen oder die Berliner Rohrpost die Novemberrevolution von 1918 ermöglicht. Im Umkreis von »Open Access« aber glaubt man allen Ernstes, es genüge die Umstellung der Publikationstechnik, um politische und gesellschaftliche Reformen auf den Weg zu bringen. Daß das nicht ganz einfach sein wird, ergibt sich schon alleine dadurch, daß auch in den Entwicklungsländern die langfristige Finanzierbarkeit der dort publizierten »Open-Access«-Journale ein Problem darstellt, daß die meisten dieser Zeitschriften in den einschlägigen Datenbanken (Web of Science, Scopus) gar nicht indexiert werden und damit unauffindbar bleiben und daß der regionale Erfolg einiger dieser Zeitschriften eben das ist, was er ist: ein regionaler Erfolg, bei dem die regional Erfolgreichen unter sich bleiben und sich in den Industrieländern niemand darum schert, was da irgendwo am Äquator digitalregional in einer »Open-Access«-Zeitschrift veröffentlicht wurde.1
Kurz: »Open Access« krankt an einer Fülle innerer Widersprüche, an der die von »Open Access« propagierte medienmaterialistische Weltsicht scheitern muß, die ein ums andere Mal uns weiszumachen versucht, der Wechsel zum Digitalmedium und der Wechsel zum »Open-Access«-Medienregime werde von ganz alleine den gesellschaftlichen Überbau hin zum Fortschrittlichen verschieben. Scheitern muß die Sache schließlich aber auch daran, daß man selbst dann, wenn man unterstellt, in den Entwicklungsländern sei eine partielle Verbesserung der Zugänge zu Wissenschaft durch »Open Access« erreichbar, die Rechnung ohne den realökonomisch-politischen Wirt macht, der in Afrika und anderswo die Wirtschaft führt. Es ist ein Wirt, der von Vetternwirtschaft lebt, Gelder für Subventionen und Entwicklungshilfe in großem Stil in die eigene Tasche steckt, an Militärausgaben seine helle Freude hat, an Sozial- und Bildungsausgaben weniger, ein Wirt, dem die Infrastruktur kein besonderes Anliegen ist (er nimmt den Jet, das genügt ihm) und der »Demokratie« etwas nennt, was bei uns eher unter dem Stichwort »kleptokratische Clanherrschaft« läuft. So mag es dann ja durchaus sein, daß man in Afrika jetzt 200 Millionen Handys und Smartphones zählt, und man mag das, ganz auf der medienmaterialistischen Linie, auf der man denkt, für das erste Anzeichen einer in die richtige Richtung weisenden gesellschaftlichen Tendenz halten. Nur müßte man dann eben angeben können, welche Relevanz diese 200 Millionen Gadgets bei einer afrikanischen Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen haben sollen: Sollen das jetzt 200 Millionen auf »Open Access« per Handy versessene Menschen sein? Und selbst wenn es so wäre, welche Relevanz hätte das angesichts der Tatsache, daß in Afrika 600 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung ohne Zugang zu Elektrizität leben müssen und daß in ganz Afrika weniger Strom als alleine in Deutschland erzeugt wird?2
 [Abb. 5: Wegweiser,
der den Weg zur Universität von Gambia weist. Quelle: Atamari auf
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.]
[Abb. 5: Wegweiser,
der den Weg zur Universität von Gambia weist. Quelle: Atamari auf
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.]
Wer auch nur ein wenig Kontakt zu einer Entwicklungshilfeorganisation hat, der weiß, daß die Probleme Afrikas (und der Entwicklungsländer auf anderen Kontinenten) ganz sicherlich nicht mit Smartphones und ebenso sicherlich nicht mit »Open Access« gelöst werden. In die Breite gerechnet bräuchte man schlicht friedliche Verhältnisse, funktionierende Schulen, Wandtafeln mit Kreide und gedruckte Schulbücher samt Heften und Kugelschreibern, um eine stabile Basis für die wünschenswerten Bildungsprozesse überhaupt erst aufbauen und die Bildung dann allmählich auch heben zu können. »Open Access« hat in diesem Kontext keine andere Funktion, als uns in den Industrieländern kollektiv von einer digitalen Wunschmaschine träumen zu lassen, die uns die moralische und politische Verantwortung für die Dritte Welt pauschal abnimmt und durch einen einfachen Medienwechsel dafür sorgt, daß alles gut wird. Aber während wir träumen und in Lagos im Slum jemand gerade den Dieselgenerator anwirft, um elektrischen Strom fürs Licht und den Fernseher zu erzeugen, sitzt in China ein sehr wacher Wissenschaftler an seinem Schreibtisch und liest die ihm per »Open Access« frei gelieferten Zeitschriftenartikel aus einer europäischen Fachzeitschrift; und er hat auch schon eine gute Idee, was man damit praktisch anstellen und wie man damit Geld verdienen kann.
 [Abb. 6: Wegweiser
auf dem Gelände der Graduate School von Shenzhen. Quelle:
Chonghaiyatsingxiao, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.]
[Abb. 6: Wegweiser
auf dem Gelände der Graduate School von Shenzhen. Quelle:
Chonghaiyatsingxiao, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.]
Anmerkungen
-
Siehe dazu den erhellenden Artikel von Andy Nobes: Open Access plays a vital role in developing-country research communication. In: INASP Blog, 10. März 2016, zu finden unter der URL http://blog.inasp.info/open-access-plays-vital-role-developing-country-research-communication/ ↩
-
Philip Plickert: Afrika ohne Strom. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Mai 2018, Seite 21. ↩
