Eines der schönsten und geheimnisvollsten Gemälde der Welt stammt von Jan van Eyck und ist unter dem Titel »Die Arnolfini-Hochzeit« bekannt. Wer das Bild betrachtet, den einen oder anderen Artikel dazu liest oder den »art inspector« dazu aufruft, findet sich darüber informiert, daß hier der reiche Kaufmann Giovanni Arnolfini abgebildet sei, der seiner zukünftigen Frau die Hand reiche für eine Ehe »zur linken Hand« (der Mann gibt der Frau seine Linke, die Frau dem Mann ihre Rechte), zu einer Ehe also, bei der die Frau geringeren Standes ist als der Mann. Und der Künstler, immer zu einem Scherz auf der Höhe seiner Kunst aufgelegt, bringe sich selbst ins Spiel, in jenem Spiegel nämlich, der hinter dem Brautpaar an der Wand hänge, das Brautpaar von hinten und außerdem zwei Personen zeige, die in der vom Bild gemeinten Realität gerade das Zimmer zu betreten scheinen: Eine der beiden Personen sei Jan van Eyck (auch wenn man ihn nicht erkennen kann), Zeuge der Zeremonie, der das dann auch über dem Spiegel in einem auf der Mauer stehenden Text festgehalten habe: »Johannes de Eyck fuit hic.« Johannes van Eyck war hier. Darunter dann die Jahreszahl 1434.
 [Abb. 1: Jan van
Eyck: Die Arnolfini-Hochzeit, 1434. Quelle: Wikimedia Commons,
Public Domain.]
[Abb. 1: Jan van
Eyck: Die Arnolfini-Hochzeit, 1434. Quelle: Wikimedia Commons,
Public Domain.]
Wie immer ist die Sache freilich komplizierter als die schnellen wikipedianischen Informatoren und künstlerischen Inspektoren meinen. Der von van Eyck dem Bild gegebene Titel ist durchaus unbekannt, und als es knapp einhundert Jahre nach seiner Entstehung zum erstenmal in einem Inventar auftaucht, ist es dort als »Hernoul-le-Fin mit seiner Frau« (der schlaue Arnolf/Arnold mit seiner Frau) eingetragen. Und seither rätselt die Kunstwelt, wer da eigentlich abgebildet ist: wirklich der Kaufmann Arnolfini, dessen Frau, mit der er hier angeblich die Ehe schließt, zum Zeitpunkt der Bildentstehung aber bereits tot war? oder Jan van Eyck mit seiner Frau? oder gar keine reale Person, sondern das Thema des Hahnreis — »Arnolf« war der Spitzname für betrogene Ehemänner – samt sündiger Ehefrau?
Man weiß es nicht, wüßte es aber gern. Um mehr zu wissen, muß man sich dem an der Wand hängenden Spiegel zuwenden, der die Szene in merkwürdiger Verkehrung zeigt. In ihm sieht man einerseits die Szene nicht nur von hinten, sondern man sieht auch Dinge und Personen, die aus der Perspektive des Betrachters nicht zu sehen sind: ein weiteres Fenster und die zwei eintretenden Personen. Und andererseits sieht man im Spiegel Dinge nicht, die man dort eigentlich sehen müßte: die Braut sieht man nur von hinten, obwohl sie eigentlich im Viertelprofil zu sehen sein sollte; das Paar, das sich von vorne gesehen die Hand reicht, steht in der Spiegelperspektive vollkommen isoliert da, nicht einmal die Arme nähern sich, geschweige denn daß da Hände ineinanderliegen. Und zwischen den beiden stehen, in der Spiegelperspektive, die beiden Eintretenden. Dafür ist der kleine Hund, der vorne zwischen dem Paar steht, im Spiegelbild verschwunden.
Wer sich das alles einmal im Detail anschauen will, macht das, was man in diesen Internetzeiten so bequem machen kann: Er ruft den entsprechenden Wikipedia-Eintrag auf, klickt dort auf das Bild und vergrößert es, um besser zu sehen, was sich da im Spiegel eigentlich tut. Nur leider: Es wird daraus nicht viel werden, denn ab einer bestimmten Vergrößerungsstufe wird das präzise Bild van Eycks zu einem verwaschenen Fleck, der nichts recht erkennen läßt.
 [Abb. 2: Die Szene im Spiegel, maximal
vergrößert. Quelle: Wikimedia Commons, Public Domain.]
[Abb. 2: Die Szene im Spiegel, maximal
vergrößert. Quelle: Wikimedia Commons, Public Domain.]
Das ist nun nicht unbedingt eine bahnbrechend-neue Mitteilung, aber man muß sich einen Moment lang die Konsequenzen klarmachen, die sich aus diesem scheinbar banalen Sachverhalt ergeben:
-
Wir werden mit einer Abbildung konfrontiert, die das Revolutionäre der Kunst van Eycks — das Malen mit Ölfarben und deren Schichtung zur Erzeugung von Farb- und Transparenzeffekten — nicht darstellen kann. Wo van Eyck die Farbe dreidimensional modelliert hat, bleibt die Abbildung im Internet zweidimensional flach.
-
Während wir uns dem Original gegenüber in verschiedene Distanzen und Wahrnehmungsmodi versetzen und das, was im Spiegel zu sehen ist, schließlich gar wortwörtlich unter die Lupe nehmen können, um soviele Details zu sehen, wie van Eyck hier hineingeheimnist hat, zum Schluß bis auf den Firnis und die Porosität des Farbauftrags kommend — scheitern wir im Internet an der Auflösung der Abbildung, ihrem Pixelmaximum, das das technische Sichtbarkeitsmaximum ist.
Und so wird, wie man oft, allzuoft, liest, die »Sichtbarkeit« des Kunstwerks im Internet womöglich erhöht, will sagen: Mehr Menschen als je zuvor können sich die »Arnolfini-Hochzeit« anschauen. Aber zugleich leiden sie alle beim Anschauen, ohne es zu bemerken, unter einem Darstellungsentzug, der sie nur sehen läßt, was die technische Zwischenschicht von JPG- und PNG-formatigen Abbildungen in ihrer Maximalauflösung von dem Bild sehen läßt, verfälscht zusätzlich durch all das, was der jeweilige Bildschirm ohne alle Farbechtheit aus den übertragenen Farbinformationen macht. Wir sehen, ob wir es wollen oder nicht und ob wir es wissen oder nicht, eine technisch gestylte Interpretation von van Eycks Bild. Eine Interpretation, die obendrein dort, wo es gerade bei diesem Bild so interessant wird, versagt.
Kunst, so sollte man meinen, ist immer und stets die Kunst des Präzisen, des Details. Eine Darstellungsform, die, wie hier, die Ebene der Werkdetails ignoriert, ist per se keine der Kunst angemessene Darstellungsform. Sie liegt auf einer anderen Ebene, die, so honorig sie sein mag (Kunst für die Massen! demokratische Kunst! Sichtbarkeit! Teilhabe!), das Kunstwerk nicht nur um Haaresbreite verfehlt, sondern um ein ganzes Universum. Dieses das Kunstwerk verfehlende Universum heißt Internet.
Man muß sich auch das noch einen guten Moment lang klarmachen, weil viele Bibliothekare inzwischen glauben, bei Büchern, die nach allgemeinem Urteil keine Kunstwerke seien — Kunstwerke seien einmalige Originale, Bücher dagegen Massenprodukte —, verhalte es sich anders. Im Falle der Bücher zählten, so meinen sie, nur die Informationen, nicht deren materielle Konkretion, wie sie sich auf dem beschriebenen oder bedruckten Papier finde. Und wo man doch einmal mehr brauche, beim schmählich so genannten »alten Buch« etwa, da könne man ja durch Digitalisierung dafür sorgen, daß dieses Mehr der am Internet hängenden Welt zugänglich gemacht werde: Massen! Demokratie! Sichtbarkeit! Teilhabe! Die Gutenberg-Bibel für alle! Endlich!
Schaut man aber auch hier auf die Details, wird man schnell feststellen, daß es nicht anders ist als mit Jan van Eycks Werk: Die Details gehen verloren, weil sie technisch bedingt schnell unter die Darstellbarkeits- und damit unter die Wahrnehmungsebene gedrückt werden. Nehmen wir als Beispiel das, was digital aus der Gutenberg-Bibel geworden ist: Sie ist in vielen im Netz zu findenden Beispielen schön anzusehen, zweifellos; und man darf sich darüber natürlich freuen. Sobald man sich aber etwa für die Frage interessiert, welche Partien der Bibel in rotem Typensatz gedruckt und welche von Rubrikatoren ausgeführt wurden, wird man mit dem, was von der Bibel im Internet zu sehen ist, nicht weit kommen. Werfen wir, um das ganz deutlich zu machen, einen Blick auf den Beginn des Buches Genesis und dort auf das rote »dicimus«:
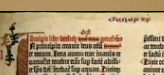 [Abb. 3: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel in Austin (Texas) aus; nicht weiter
vergrößerbar. Quelle: Harry Ransom Center, The University of
Texas at
Austin.]
[Abb. 3: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel in Austin (Texas) aus; nicht weiter
vergrößerbar. Quelle: Harry Ransom Center, The University of
Texas at
Austin.]
 [Abb. 4: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel an der UB Frankfurt am Main aus;
maximal vergrößert. Quelle: Universitätsbibliothek
Frankfurt.]
[Abb. 4: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel an der UB Frankfurt am Main aus;
maximal vergrößert. Quelle: Universitätsbibliothek
Frankfurt.]
 [Abb. 5: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel in der National Library of Scotland
aus; maximal vergrößert. Quelle: National Library of
Scotland.]
[Abb. 5: So sieht das »dicimus« zu Beginn des Buches Genesis im
Exemplar der Gutenberg-Bibel in der National Library of Scotland
aus; maximal vergrößert. Quelle: National Library of
Scotland.]
Man kann das gerne für alle weiteren »im Netz« zu findenden Exemplare durchexerzieren; das Ergebnis wird immer dasselbe sein: Man sieht die relevanten Details nicht. Auf der Basis der Digitalisate wird man daher keine Antwort auf die Frage finden, ob die hier interessierende Passage von Hand rubriziert oder gedruckt wurde.1
Nun gut, wird man sagen, so etwas sei für »das alte Buch« mißlich, aber für das neue Buch ganz und gar irrelevant. Denn dort interessiere ja nicht die künstlerisch-technische Verfaßtheit des Buches als solchen, sondern nur der Text oder eben die Information, die sich in dem Text finden lasse. Hier sei die Grenze vom Kunstwerk zur alltäglichen Mitteilung klar überschritten, und niemand müsse sich darüber Gedanken machen, in welcher medialen Gestalt diese Mitteilung erfolge; Hauptsache, sie erfolge und werde verstanden. Aber wie soll man sich dieses Verstandenwerden denken, wenn es auch hier mit so vielen technisch-digitalen Mucken zugeht, daß der Text, diese angeblich so einfache schwarze Buchstabenlinie auf weißem Papier (und nun eben hellem Bildschirm), überall zu flattern und buchstäblich auszureißen beginnt, als scheue er sich, im Digitalen in seiner integralen Form zu erscheinen?
So behauptet beispielsweise der de-Gruyter-Verlag auf der Website seiner Theologischen Realenzyklopädie Online, man finde dort »ein unabdingbares Standardwerk für die Theologie« (stimmt) und es handle sich dabei um eine »exakte Wiedergabe des Volltextes« (stimmt nicht). Der Leser findet auf seinem Bildschirm u.a. nämlich das folgende Digitalisat, das auch im Ausdruck auf einem Blatt Papier nicht besser wird und das man kaum als eine »exakte Kopie« der vorbildlich gedruckten Enzyklopädie bezeichnen kann:
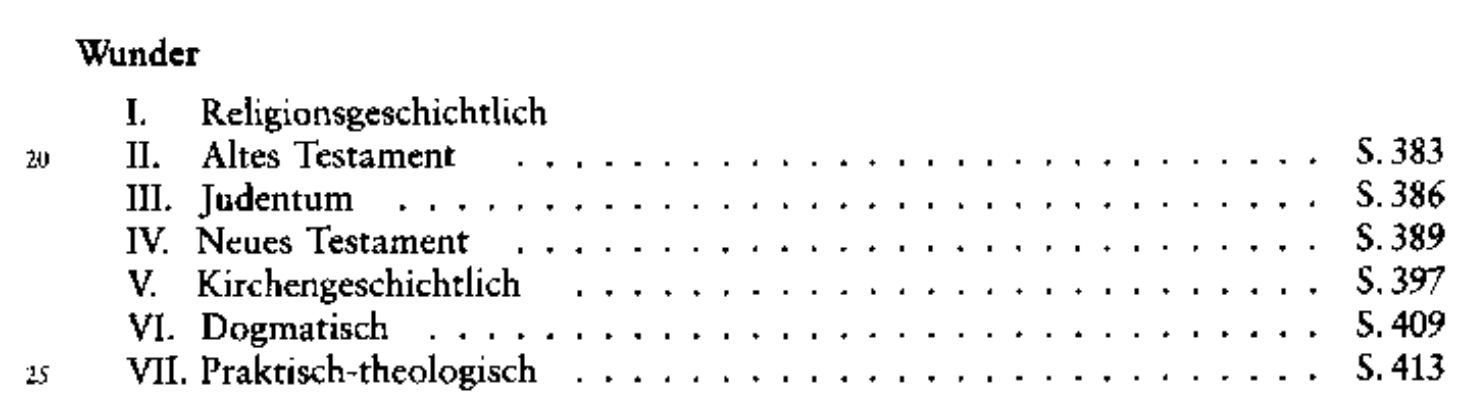 [Abb. 6: Beginn des Art. »Wunder« in der Theologischen
Realenzyklopädie Online. Quelle: Website des
de-Gruyter-Verlages.]
[Abb. 6: Beginn des Art. »Wunder« in der Theologischen
Realenzyklopädie Online. Quelle: Website des
de-Gruyter-Verlages.]
Lesen kann man das irgendwie schon, aber es ist weit von dem entfernt, was man von einem Standardwerk erwarten sollte, nämlich die optimale Darstellung dessen, was sich so obenhin »Inhalt« nennt. Diesen »Inhalt« aber gibt es in einer massiven Weise nur dann, wenn er in angemessener Form in einem angemessenen Medium dargestellt wird. Mit der hier gut sichtbaren Verpixelung des Textes wird auch der »Inhalt« verpixelt, verflüchtigt sich von einem gewichtigen Standard zu einem beliebigen »Content«, der vom Verlag als digitales »Produkt« vermarktet und von den Bibliotheken als digitales »Produkt« lizenziert (nicht: gekauft) wird und so sauer-zerflockt daherkommt wie die Milch an einem zu heißen Sommertag.
Von solchem verpixelten und verfleckten Zeug ist die digitale Bibliothekswelt übervoll, und ihr massenhaftes Vorkommen scheint längst den Blick dafür getrübt zu haben, daß dieses Zeug jenseits aller Qualität angesiedelt ist und in den Bibliotheken eigentlich nichts zu suchen hat. Aber offenbar sorgt die leichtfertige Illusion des schnell am Bildschirm Verfügbaren dafür, daß man hinnimmt, was man in analogen Druckzeiten niemals hingenommen hätte, was dort vielmehr umgehend an den Verlag zurückgeschickt worden wäre. Beispielsweise so etwas:
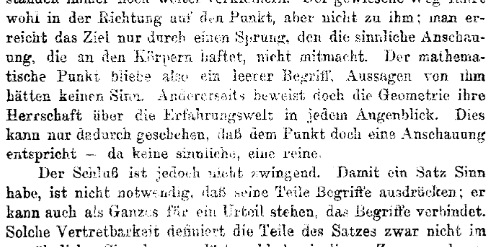 [Abb. 7: Digitalisat aus den Kant-Studien 24 (1920),
S. 109, bereitgestellt über die »Nationallizenzen«.]
[Abb. 7: Digitalisat aus den Kant-Studien 24 (1920),
S. 109, bereitgestellt über die »Nationallizenzen«.]
Oder das:
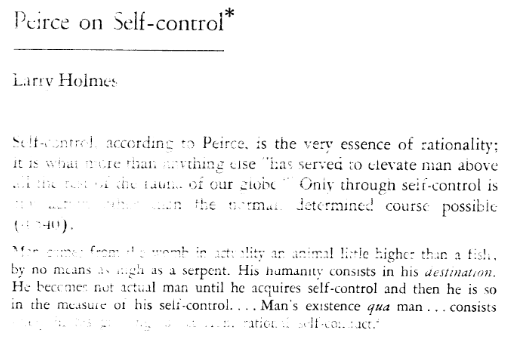 [Abb. 8: Digitalisat aus den Transactions der Charles
S. Peirce Society 2 (1966), S. 113, bereitgestellt über die
»Nationallizenzen«.]
[Abb. 8: Digitalisat aus den Transactions der Charles
S. Peirce Society 2 (1966), S. 113, bereitgestellt über die
»Nationallizenzen«.]
Oder endlich das:
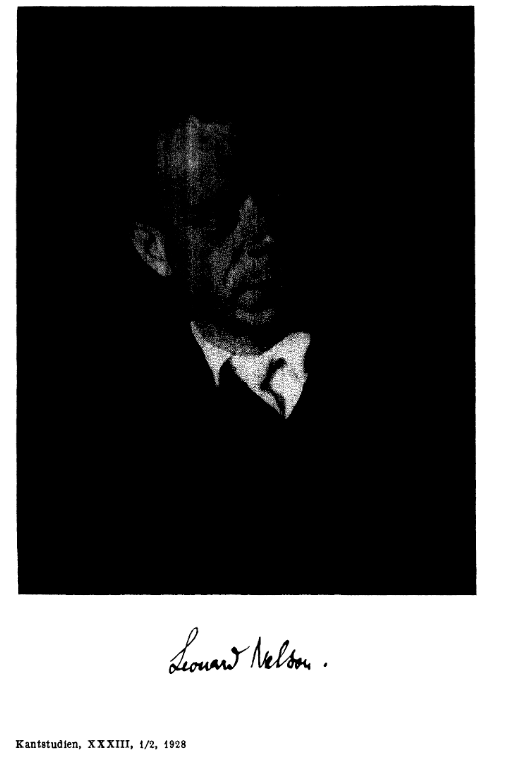 [Abb. 9: Digitalisat aus den Kant-Studien 33 (1928),
S. 249, bereitgestellt über die »Nationallizenzen«.]
[Abb. 9: Digitalisat aus den Kant-Studien 33 (1928),
S. 249, bereitgestellt über die »Nationallizenzen«.]
In dem von diesen Beispielen aufgespannten digitalen Darstellungskontinuum, das von »gerade so lesbar« bis zu »völlig unbrauchbar« reicht, verschwindet jede Rede vom »Content«. Denn was wäre dieser »Content« jenseits dessen, was hier alles nicht mehr zu sehen ist? Wäre er das, was er ohne die von den Beispielen so sichtbar ausgestellten Patzer wäre? Wer das glaubt, versieht sich darin, daß selbst dann, wenn hier nicht gepatzt worden wäre, das Digitalisat des Textes nicht anders als das Digitalisat der »Arnolfini-Hochzeit« eine hochproblematische technische Interpretation des Originals wäre, dessen komplexe Eigenschaften auf das reduziert sind, was der jetzige Stand der Technik und des jetzige Vorverständnis von textuellen Relevanzen zuläßt. Alles andere fällt unter den Tisch und ist, weil es im Digitalen keine materiellen Abfälle gibt, auf immer und ewig verschwunden. Die größere »Sichtbarkeit«, die man auf den digitalen Wegen erreicht, ist daher die Kehrseite einer interpretatorisch verarmten Darstellung der Originale, die sich im Rausch der Begeisterung darüber, was da nun alles »sichtbar« gemacht wird, dieser Verarmung gar nicht mehr bewußt wird.
Wenn sich die Dinge aber so verhalten, dann sollte man endlich aufhören, die Digitalisierung von Büchern mit anderen Augen zu betrachten als die Digitalisierung von Kunstwerken. In beiden Fällen geht es um eine interpretierende technische Transformation, die vom Original (sei es ein Einzelstück, sei es eine Serie) viel zu wenig übrigläßt, als daß sie als vollgültiger Ersatz für das Original betrachtet werden dürfte. Wie weit wir davon entfernt sind, diese einfache Wahrheit in den Bestand unserer kulturellen Selbstverständlichkeiten zu integrieren, zeigt sich immer dann, wenn die erstaunte Öffentlichkeit wieder einmal feststellen muß, daß eine Bibliothek durchaus nicht als treue Sachwalterin der gedruckten Überlieferung agiert. Man kann in solchen lichten Momenten rasch lernen, daß die digitalbegeisterte Politik von Tiefschwarz bis Hellgrün sofort Schützenhilfe leistet und von Amts wegen ministeriell feststellt, daß auf die Digitalisierung von Gedrucktem natürlich eine Makulierung — im Klartext: Wegwerfen — der Originale erfolgen dürfe. Offenbar ist es für die als Vormund agierende Politik längst völlig in Ordnung, das staatliche Eigentum an originalen Büchern und Zeitschriften aufzugeben, die gedruckten Bände einstampfen zu lassen und die kulturinteressierte Öffentlichkeit mit digitalen Surrogaten abzuspeisen.
Was hier abhanden gekommen ist, ist der Respekt vor der Überlieferung, wie sie vorliegt. Daß sie in vielen Fällen in materiell bedenklicher Form vorliegt, von der bröseligen Keilschrifttafel, dem Pergament, durch das sich die Tinte frißt, bis hin zur brüchig-braunen Zeitungsseite, ist nicht der Punkt, um den es hier geht. Denn natürlich gibt es Mittel und Wege, auf solche Hinfälligkeiten durch geeignete Restaurierungsmaßnahmen zu reagieren. Der Punkt, um den es hier geht, ist die leichtfertige Annahme, die Digitalisierung ersetze das Original oder sei der Ersatz einer nötigen Restaurierung des Originals, also so etwas wie ein Ersatz in zweiter Potenz. Das ist eine Annahme, die falscher nicht sein könnte, denn sie führt von der historischen Bahn, in der die Originale stehen, in einem rechten Winkel ab ins Reich der digitalen Ermächtigungsphantasien, in dem ein jeder glaubt, die Welt, wie sie ist, mit all dem, was in ihr vorkommt, von der »Arnolfini-Hochzeit« bis zum Porträt von Leonard Nelson, in eine neue und bessere Seinsstufe heben zu können, die digitale eben, in der man sich um die Materialitäten nicht mehr scheren muß.
 [Abb. 10:
Margarete van Eycks Mund sagt nichts. Quelle: Städtisches Museum
für Schöne Künste, Brügge; Wikimedia
Commons,
Public Domain.]
[Abb. 10:
Margarete van Eycks Mund sagt nichts. Quelle: Städtisches Museum
für Schöne Künste, Brügge; Wikimedia
Commons,
Public Domain.]
Kunst ist, so sagte ich, die Kunst des Details. Eine andere Kunst gibt es nicht. Die Kunst des Details ist freilich immer auch die Kunst, das Detail mit der richtigen Technik ans Licht zu bringen. Van Eyck hat hier für lange Zeit in der bildenden Kunst einen Maßstab gesetzt, und auf dem Gebiet der Druckkunst waren es wenig später Johannes Gutenberg und noch etwas später Aldus Manutius, die die Expertise des Philologen mit der Expertise des Druckers zur Synthese brachten und Bücher schufen, die bis heute vorbildlich sind. Daß es Kunst nicht ohne Technik gibt und beides einmal so ziemlich dasselbe meinte, heißt jedoch nicht, daß es genügt, mit viel Technik irgendetwas zu machen und womöglich mit allerneuester digitaler Technik den historischen Beständen unserer Kultur zuleibe zu rücken. Wer das meint und entsprechend handelt, läßt nur die Technik von der Leine, und was dabei herauskommt, kann man seit Jahren in den Bibliotheken beobachten. Wir sollten es anders machen und aus dem Beobachteten die richtige Lehre ziehen.
Weiterführende Literatur
für neugierige und aufklärungswillige Leser, die verstanden haben, daß kein Vormund an ihrer Stelle denken und handeln darf:
Anita Albus: Die Kunst der Künste. Erinnerungen an die Malerei. Frankfurt am Main: Eichborn, 1997.
Michael Hagner: Zur Sache des Buches. 2., überarb. Aufl. Göttingen: Wallstein, 2015.
Uwe Jochum: Bücher. Vom Papyrus zum E-Book. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2015.
Jean-Philippe Postel: Der Fall Arnolfini. Auf Spurensuche in einem Gemälde von Jan van Eyck. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 2017.
Roland Reuß: Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2012.
Roland Reuß: Die perfekte Lesemaschine. Zur Ergonomie des Buches. Göttingen: Wallstein, 2014.
Michael Schikowski: Warum Bücher? Buchkultur in Zeiten der Digitalkultur. Frankfurt am Main: Bramann, 2013.
Yvonne Yiu: Jan van Eyck — das Arnolfini-Doppelbildnis. Reflexionen über die Malerei. Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2001.
Anmerkung
-
Ich kann den Leser beruhigen: Die Frage ist in der realen Welt jenseits des Netzes längst beantwortet, in der guten Sekundärliteratur, die es zu Gutenberg und seiner Bibel gibt. ↩
